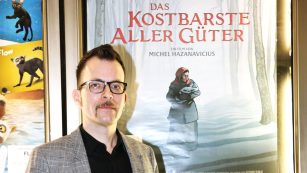Mindestens 70 Jahre hat es in der Erde gelegen. Jetzt, in der Restaurierungswerkstatt der Gedenkstätte Buchenwald, wird es vor dem Vergessen gerettet. Irgendwann haben die Nazis es auf die Müllhalde geworfen. Junge Leute, sie sind zwischen 19 und 27 Jahre alt, sehen sich dieses Schmuckstück nun interessiert an. Ein Stern, der einmal eine ungarische Münze war. Sie trägt jetzt die Initialen F.M. Das »Israel« zwischen Vor- und Nachname hat der Mann aus Lodz weggelassen. Wer war F. M.?
Stefanie Masnick, die Leiterin der Restaurierungswerkstatt, ist sehr berührt von diesem Fund, der bei archäologischen Grabungen auf dem Gedenkstättengelände in Buchenwald entdeckt wurde. Dieser Mann wird dem Vergessen entrissen. »F.M.« Vier polnische Juden mit diesen Initialen gab es in Buchenwald.
Öffentlichkeit Doch der Mann, der diesen Schmuckstern gemacht hat, hat neben seinen Anfangsbuchstaben auch noch »Zentrales Arbeitslager Blechhammer« eingraviert. Und das Jahr 1942. Und plötzlich ist in der Gedenkstätte klar, wer F.M. ist. Derzeit wollen die Mitarbeiter den Namen nicht an die Öffentlichkeit geben. Weil sie noch nach lebenden Verwandten in Polen suchen.
Dass tatsächlich so viel Geschichte zu erleben ist, hat Sascha Araslanow aus Perm (Russland) nicht vermutet, als er sich über die gemeinnützige internationale Organisation SCI (Service Civil International) für die Grabungen in der Weimarer Gedenkstätte angemeldet hat. Ja, er wollte mehr über Deutschland, mehr über Buchenwald wissen.
Nun also sitzt er in der Restaurierungswerkstatt und hält ein Medizinfläschchen in der Hand. Er arbeitet mit Mundschutz und Handschuhen, alles nach Vorschrift. Und er stellt sich vor, wem dieses Fläschchen gehört haben könnte. Einem Mann mit schwachem Herzen? Einer Frau mit Erkältung? Er wird es nicht erfahren. Aber vorstellen kann er sich vielleicht, wie das damals war, als das Fläschchen benutzt wurde. Sascha wird an diesem Tag auch noch ein Stück Glas reinigen und Metall, das vielleicht einmal zu einem Teller gehört hat. Geschichte zum Anfassen. Abgeladen auf der Müllhalde, auf der heute Bäume wachsen und Gras.
FUNDE Stattdessen gibt es Funde unterhalb des sogenannten Kleinen Lagers im Wald. Varvara Byryulyaewa holt mit einem Spaten Erde von dem kleinen Hügel und wirft sie in einen Korb. Vorsichtig, damit nichts kaputtgeht. Dann nimmt sie ein Sieb. Schüttet Erde hinein und rüttelt. Die Erde fällt zu Boden, im Sieb bleiben Porzellanreste und ein Stück Metall, verklebt mit feuchter Erde. Es hat schließlich geregnet am Tag zuvor. Heftig geregnet. Deshalb nimmt sie eine Art Waschbürste und reinigt die Fundstücke grob, damit sie keine Besonderheit übersieht. Archäologie mit politischem Hintergrund.
Plötzlich hält Kamilla Shoshina (Russland) etwas in die Luft. Es wirkt zerbrechlich. Wie gut, dass auch sie nur vorsichtig in der Erde wühlt. Janna Perbix, Studentin aus Leipzig, entfährt ein langgezogenes »Meensch«. Möglicherweise haben sie eine Pipette entdeckt. Vielleicht hatte ein Häftling sie ins Lager geschmuggelt, um eine Augenkrankheit zu behandeln. »Es ist ein komisches Gefühl, diese Pipette in der Hand zu halten«, sagt Janna Perbix. Sie ist bereits zum vierten Mal in Buchenwald.
Neben ihr arbeitet Alexandra Ochman aus der Ukraine. Auch sie rüttelt das Sieb, schaut nach Gegenständen. Vielleicht haben sogar Landsleute diese Dinge in der Hand gehabt. Alexandra spricht nahezu perfekt Deutsch, weil sie ein Semester lang in Jena studiert hat. Ihre Bachelorarbeit hat sie über Gulags, die Straflager in der ehemaligen Sowjetunion, geschrieben. »In der postsowjetischen Zeit gibt es noch keine Gedenkstätten«, sagt sie. »Zu Hause wissen sie auch nicht, was hier in Buchenwald nach 1945 geschah«, fügt sie hinzu. Die junge Frau will das ändern. Von dort erzählen und von hier. Und vielleicht auch selbst eine Gedenkstätte über einen Gulag konzipieren.
Genickschussanlage Sie lebt in Kiew. Dort ist es sicher, sagt sie. Ihre Heimatstadt Dnepropetrowsk liegt jedoch weiter östlich in der Ukraine. Ihre Eltern, beide Ärzte, wohnen immer noch dort. Jeden Abend schaut sie in Weimar fern, um sich die Nachrichten aus der Heimat anzuschauen. Das geht Kamilla Shohina nicht anders. Die Russin kann diesen Streit nicht verstehen. Gerade hier, in Buchenwald, wo Menschen ermordet wurden, die Nazis die Genickschussanlage auch gegen 8000 sowjetische Soldaten verwendet haben, wirkt ein Krieg unsinniger als sonst wo. Die beiden Frauen unterhalten sich am Abend über die Situation in ihren Ländern.
»Sie können einander zuhören«, sagt Jan Malecha. Er ist pädagogischer Mitarbeiter der Gedenkstätte und sorgt für inhaltliche Vielfalt im Camp. Einen halben Tag lang arbeiten die Jugendlichen ganz praktisch. Die andere Tageshälfte ist Zeit für Führungen und Exkursionen. Erfurt ist nicht weit und Weimar auch nicht. Sie haben sich schon notiert, dass es in Weimar ein Festival gibt. Die Teilnehmer der Grabungen wohnen zusammen in der Jugendherberge unweit des Eingangs zur Gedenkstätte, kochen selbst und haben nahezu immer Zeit zu reden.
Die brauchen sie auch. Denn hier in der Gedenkstätte stürmt enorm viel auf sie ein. »Aber ich wollte mehr über den Faschismus erfahren und selbst etwas dagegen tun«, sagt Maria Sporichina aus Russland und hofft, dass viele Jugendliche hierherkommen werden. »Krieg ist ein Fehler, der nicht wiederholt werden darf«, sagt die 19-Jährige.
ERINNERUNG Natalia Mazuev aus Moldawien ist an diesem Tag einige Kilometer von den anderen entfernt. Sie steht an einem Stein und meißelt einen Namen hinein. Der Gedenkweg der Buchenwaldbahn wirkt geradezu idyllisch. Doch genießen kann das niemand, der hier entlanggeht. 200 Steine liegen bereits am Pfadrand. Darauf stehen die Namen 200 ermordeter Kinder von Sinti und Roma. Von hier, von Buchenwald, wurden sie ins Vernichtungslager Auschwitz gebracht.
Auf manchen Malen liegen Steinchen. Die müssen jüdische Besucher hingelegt haben. Vielleicht, als sie nach Spuren eigener Angehöriger gesucht hatten. Denn von hier wurden 2000 Mädchen und Jungen nach Auschwitz deportiert. Derzeit werden 111 Steine für ungarisch-jüdische Kinder präpariert. So erhalten anonyme Opfer wieder einen Namen. Die Steine stammen aus einem Fluss in Sachsen.
Die Idee für diese Mahnmale und den Gedenkweg stammt von Heiko Clajus aus Weimar. Ihm hatte gefallen, was Beate und Serge Klarsfeld mit ihrer Ausstellung über jüdische Kinder in Frankreich gemeinsam mit der französischen Bahn bewegt hatten. »Da es in Deutschland auf diese Weise nicht möglich war, kam mir die Idee mit den Denksteinen«, sagt er.
Denksteine Pro Jahr sind es etwa 30 Steine, die beschriftet werden können. Mehr schaffen sie nicht. Auch Natalia Mazuev sagt, dass das Meißeln Zeit braucht. »Es soll gut werden«. Sie ist Verwaltungsangestellte in Münster und hat sogar Urlaub genommen, um bei der Gedenkstättenarbeit in Buchenwald dabei sein zu können. Noch bis zum Wochenende wird sie in Buchenwald mithelfen an den Denksteinen gegen das Vergessen.
Für Robin Spindler aus Kassel hingegen ist das Workcamp nur der Auftakt für die nächsten Monate. Er hat sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Gedenkstätte entschieden. »Geschichte interessiert mich«, sagt er. Und er sagt auch das: »Solche Gedenkstätten müssen unbedingt erhalten werden.«
Irgendwann, vielleicht noch in diesem Jahr, wird die Öffentlichkeit erfahren, wer F.M. war. Der jüdische Goldschmied aus Lodz, der nach nur wenigen Wochen in Buchenwald gestorben ist.