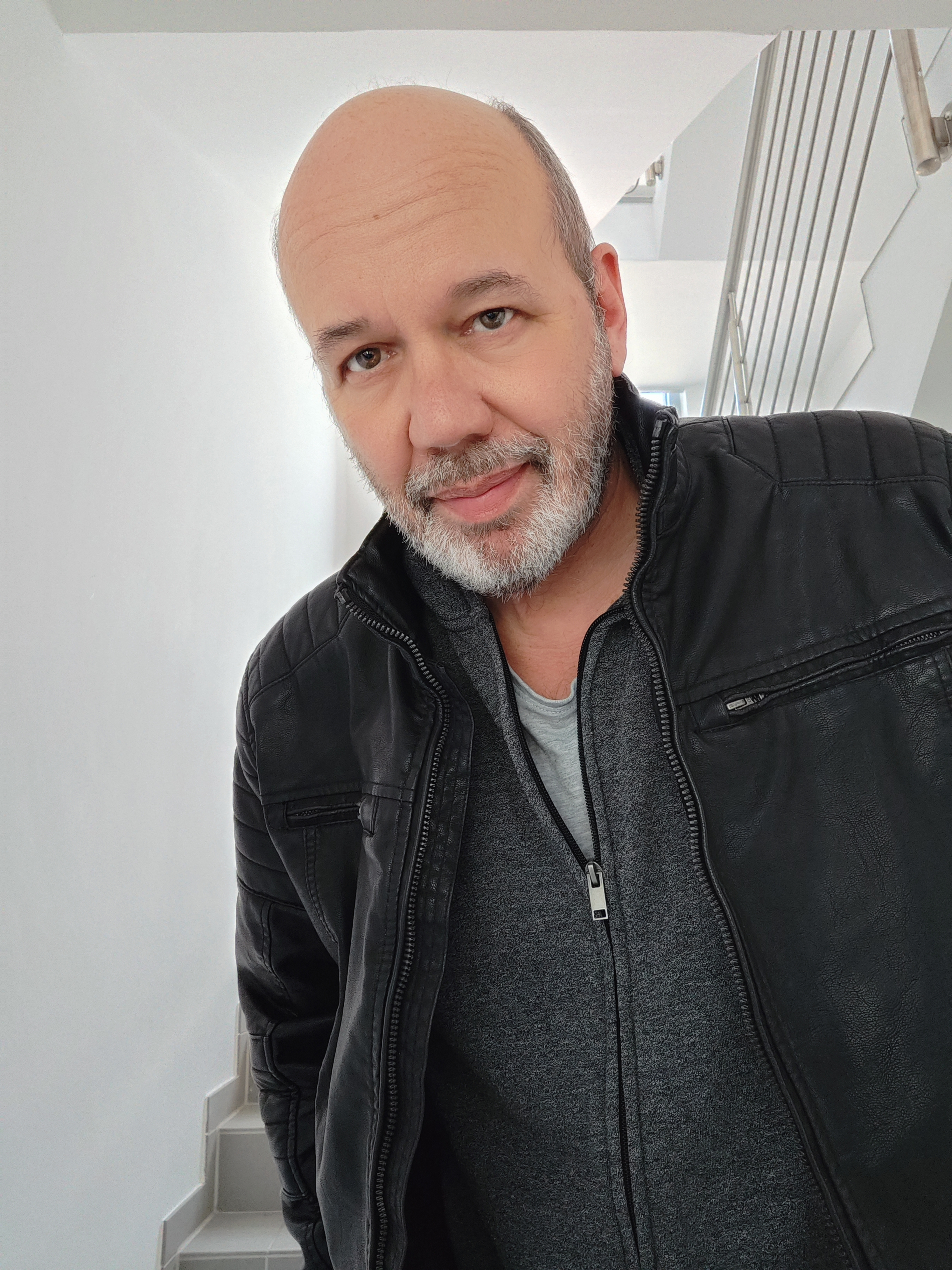Ein bislang viel zu wenig beachtetes Thema stand vergangene Woche bei einer Podiumsdiskussion mit dem Titel »Ostdeutsche Juden: Emanzipation von der Geschichte« im Klaus Mangold Auditorium der Berliner W. Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums auf dem Programm: Wie lebte es sich als Jüdin oder Jude in der Deutschen Demokratischen Republik? Drei Zeitzeugen, die Autorin Anetta Kahane, ihre Kollegin Marion Brasch sowie der Musiker und Buchautor André Herzberg sprachen über ihre persönlichen Erfahrungen.
Die Familien aller drei Teilnehmer der von George Kohler moderierten Diskussion kehrten nach dem Krieg zurück – und zwar in die Sowjetische Besatzungszone beziehungsweise in die DDR. In manchen jüdischen Familien, wie der von Anetta Kahane, wurden große Fragen diskutiert: »Wieso Ost-Berlin? Seid ihr denn bescheuert?«
Mutter Für andere Juden ging es weniger darum, dass sie nun in der kommunistischen DDR lebten, sondern eher um die Frage, warum sie ausgerechnet nach Deutschland zurückkehren mussten, ins Land der Täter. Dies war in der Familie von Marion Brasch Thema. Bei André Herzberg war es die Mutter, die bei Spaziergängen auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee die Frage stellte: »Warum hier?« Sein Vater sah dies anders. »Er war 250-prozentig«, so Herzberg.
Jüdische Kommunisten, die hinter der DDR standen, gab es durchaus. In vielen Fällen setzte sich erst spät die Erkenntnis durch, dass im Arbeiter- und Bauernstaat etwas nicht stimmte. »Bei meinen Eltern war es unentschieden«, sagte Kahane.
Marion Brasch erzählte von ihrem Vater, der das Judentum aufgrund der Heirat seiner Mutter mit seinem katholischen Stiefvater ablegte: »Er ist zum Katholizismus konvertiert – und dann nochmal, zum Kommunismus.« Anders verhielt es sich mit ihrer Mutter. Sie kam aus einer großbürgerlichen, jüdischen Familie aus dem 1. Bezirk in Wien und verhielt sich entsprechend. »Sie hat ihren 1. Bezirk dann mit nach Karl-Marx-Stadt genommen« und habe selbst als Kommunistin eine Abneigung gegen die DDR gezeigt.
Synagoge André Herzbergs Mutter war »auf der einen Seite eine sehr politische Person. Sie war Staatsanwältin, also hat sie Leute in den Knast gebracht. Auf der anderen Seite sind wir in die Synagoge gegangen, in der Rykestraße«. Herzberg selbst, der Sänger der Band Pankow war, hatte ein Privileg: Er konnte aufgrund seiner Prominenz und seiner Konzerte in den Westen fahren. Diese Reisen seien sein Ventil gewesen. »So nahm ich die DDR immer mehr als offene Psychiatrie wahr.« Erst nach der Wende habe er sich gefragt: »Warum bin ich nicht gegangen?«
»Ich habe sehr gut funktioniert«, sagt Marion Brasch. »Meine Brüder haben rebelliert, aber ich nicht. In der Familie war es mein Job, nicht zu rebellieren.«
Anetta Kahane steckte derweil ihr Leben lang »in einer etwas vernebelten Wolke«, wie sie es auf dem Podium formulierte. »Es war eine Art Unklarheit, Diffusität, in einer Welt, in der ich immer dachte, hier stimmt etwas nicht.« Dann wurde ihr klar, »dass die DDR voll war von alten Nazis. Es war eine Nachfolgegesellschaft des Nationalsozialismus«. Die Behauptung ihrer Eltern, wonach alle DDR-Bürger Antifaschisten gewesen seien, »stimmte einfach nicht«. Als Dolmetscherin begleitete Kahane »Genossen« nach Afrika. Diese seien ihr dort allerdings durch »ungebrochenen Rassismus« aufgefallen. »Damit war die DDR für mich erledigt.« Imanuel Marcus