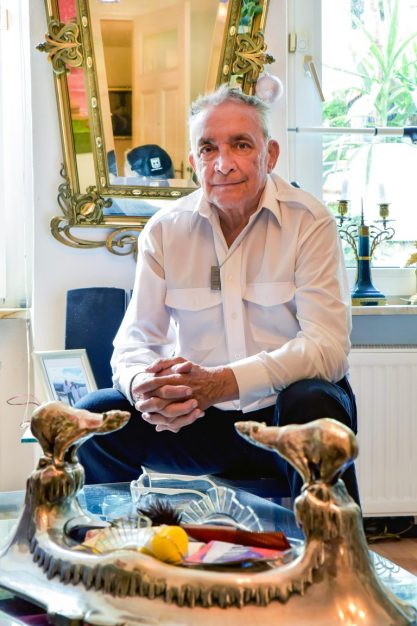Wie man es nennt, war ganz ohne Bedeutung. Zuckerbäcker, Süßspeisenkoch oder Patissier. Für mich war diese Ausbildung die einzige Möglichkeit, ein Dach über dem Kopf zu behalten. In der Nachkriegszeit gab es eine Menge alleinstehender, manchmal schon etwas älterer Frauen. Und ich hatte das Pech, dass meine Mutter auch zu den scheinbaren Witwen gehörte, obwohl mein Vater nicht tot war. Wir lebten in Herne in Westfalen, meiner Geburtsstadt. Mein leiblicher Vater hatte uns längst Richtung Nordamerika verlassen. Beide waren jüdisch.
Der Erzeuger machte sich also einfach aus dem Staub. Für mich ein Schlamassel. Der neue Freund meiner Mutter, ein wesentlich jüngerer Mann, stellte sie vor die Wahl: entweder eine standesgemäße Ehe ohne mich oder gar keine. Sie mussten mich loswerden. Und das in einer Zeit, in der Deutschland noch längst kein Sozialstaat mit Bürgergeld und Ähnlichem war. Die karge Periode ohne Bindung zu einer Familie begann. So kam ich – wie damals in der Hotelbranche üblich – zu einer Ausbildung mit Wohnrecht und Kost. Das war die einzige Möglichkeit. Drei Jahre blieb ich dabei, lernte das Handwerk.
Italien, Schweiz und Süddeutschland
Ein abwechslungsreiches und bunteres Leben konnte beginnen. Italien, Schweiz und Süddeutschland hießen die Stationen. Länger als ein halbes Jahr blieb ich nirgends in den Hotels. 1966 wurde ich für etwa vier Monate der Privatkoch der Witwe des ägyptischen Königs Faruk. Der war aus dem Land gedrängt worden, mittlerweile tot. Sie lebte in Bonn, das ja Bundeshauptstadt war. Nach der kurzen Zeit bei ihr mit Gästen, für die ebenfalls viel gekocht werden musste, hatte ich die Nase voll.
Damals wurde viel getrampt. Das war einfach üblich, also »in«, wie man sagte. Welche jungen Leute konnten sich schon ein Auto leisten? Ich stellte mich in Bonn an die Autobahnauffahrt, neben mir etwa 15 andere frierende Tramper. Mein Ziel war der Ruhrpott, am besten Herne. Doch es war kalt, nasser Schnee bedeckte im April die Straße, einfach ungemütlich.
Ein riesiger Lkw, der mit Obst aus Italien nach Berlin wollte, hielt genau vor mir an. »Ich fahre nach Berlin«, sagte der Fahrer. Bei den Temperaturen durfte die Entscheidung nicht lange dauern. Im Grunde war die geteilte Stadt für mich beinahe ein Ort in der Sowjetunion, außerhalb der westdeutschen Zivilisation. Ohne Plan und durch reinen Zufall kam ich so 1966 in Berlin an.
In einem Leihhaus erwarb ich ein eigenes Instrument.
Hier hatte gerade die »Hippiezeit« begonnen. Die ersten Kiffer von Berlin waren GIs, die hier »Mary Jane«, Cannabis, konsumierten. In der Kaserne war das nicht möglich, doch an den Stufen der Gedächtniskirche, einem Angelpunkt der Berliner Jugend, konnten sie in Zivilkleidung sitzen. Es wurde auch meine Ecke. Jemand brachte mir das Spiel auf der Gitarre bei. In einem Leihhaus erwarb ich ein eigenes Instrument, genoss mein neues Leben als Musiker auf der Straße. Es war auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen.
Gleichzeitig wunderten sich einige in einem Kreis Gleichgesinnter, wie ich meine selbst gedrehten Zigaretten mit weiterem Inhalt füllen konnte. Ich erklärte ihnen, dass es da eine Quelle gab. So war ich nicht nur Konsument. Dies aber hauptsächlich, weil ich von Bekannten bedrängt wurde. Natürlich konnte so gleichzeitig der eigene Konsum von Gras finanziert werden. Meine Englischkenntnisse durch die Folkmusik halfen, den Kontakt zu den amerikanischen Soldaten zu halten. Die bürgerliche Vergangenheit war passé.
Auch im »Steve Club« konnte man mich hören
Mein Onkel Erich, den ich hier wiederentdeckt hatte, half mir bei der Wohnungssuche. Er war Hauswart in der Schöneberger Gotenstraße. Mein Aufenthaltsort blieb aber die City. Etwa 500-mal trat ich im Folkpub »Go-In« in der Bleibtreustraße auf. Auch im »Steve Club« konnte man mich hören. Beide waren angesagte Läden in den 70er-Jahren. Heute trete ich manchmal noch in Seniorenhäusern auf. Mein Repertoire blieb über die Zeit immer gleich: Bob Dylan, Donovan, Leonard Cohen, Joan Baez. Eigentlich möchte ich mich damit nicht hervortun, doch Leonard Cohen war ich hier mehrmals in Konzerten in Berlin sehr nahe – als einer seiner Zusatzgitarristen.
Menschen mit wenigen Angehörigen baten meinen Onkel, bei Wohnungsräumungen zu helfen. Es korrespondierte genau mit der Zeitstimmung, dass plötzlich auch in Berlin, wie in europäischen Großstädten längst, ein Flohmarkt eröffnet hatte. Die nostalgische Welle war nicht mehr aufzuhalten. Der erste dieser Märkte im Freien lief bereits. Nicht, wie oft angenommen wird, auf dem Klausener Platz, sondern vor dem und um das Kino »Delphi« in der Kantstraße herum. Keller und Dachböden mussten damals wegen der Brandgefahr oft unter Druck geräumt werden. Die Zeit der Sperrmüllabholung von der Straße kündigte sich an. Ein Eldorado für Individualisten wie mich.
Die Preise für schöne Dinge kannte ich nicht
Entweder bekam ich Objekte von Onkel Ernst, der mehrere große Lager hatte, oder ich griff in den Bezirken bei den Wilmersdorfer Witwen beim Möbelangebot zu. Es war alles reichlich vorhanden. Die Preise für schöne Dinge kannte ich nicht. Manch interessante Skulptur aus Bronze ging für zehn Mark über meinen Flohmarkt-Tisch.
Seit etwa 2009 hat sich ein Interesse für Klezmer und Cafés, in denen es musikalisch jüdisch zugeht, in mein Leben eingeschlichen. Ich lernte das Café »Bleibergs«, heute geschlossen, kennen. Mit 63, also 2009, habe ich zum ersten Mal als Erwachsener die Gebäude einer jüdischen Gemeinde von innen gesehen. Meine Familie war – so will ich es nennen – religionsfrei. In Berlin spielte es aus keiner Richtung eine Rolle, dass meine Mutter das Ghetto von Vilnius in Litauen überlebt hatte. Ich hieß ja auch nicht Wolffsohn, der Name meines Vaters, der ungarischer Zwangsarbeiter gewesen war. Verheiratet waren meine Eltern nicht. Das ging ohne Papiere gar nicht.
Für die Synagoge der orthodoxen Gemeinde in Berlin bin ich nun in eine Aufgabe hineingewachsen.
Rabbiner Yitshak Ehrenberg hat einen nicht geringen Anteil daran, dass sich irgendwann bei mir etwas änderte. Für die zentrale Synagoge der orthodoxen Gemeinde in Berlin bin ich nun in eine Aufgabe hineingewachsen. In einem weiteren Sinn gibt es eine Ähnlichkeit mit meinen früheren Transporten in der Antiquitätenbranche. Nur, dass es heute keine empfindlichen Kleinantiquitäten oder polierte Möbel sind. Für die zuverlässige und aufmerksame Anlieferung von Fleisch für die Gemeinde hält man mich für den richtigen Mann.
Irgendwann war der einfache Zugriff auf Ware schwieriger geworden. Da eröffnete ich in der Schöneberger Goltzstraße meinen ersten Laden mit Edeltrödel. Der Wirt verlangte 49 D-Mark Miete. In dieser Straße etablierte sich ein Laden neben dem anderen. Die Geschäfte liefen gut, schnell gab es einen viel größeren Laden in der Eisenacher Straße, übernommen von Herrn Loewy. Silwa, meine Frau, half mit, sogar beim Möbelschleppen. Zwei Angestellte arbeiteten die Antiquitäten auf.
Viel mehr konnte man hier nicht erreichen. So ließen wir 1985 die Lkws packen, um das Savoir-vivre in dem Land zu spüren, dessen Sprache ich heute perfekt spreche. Es ging nach Frankreich, nach Sarlat. Manche würden es ein Schloss nennen, das wir nun bewohnten. Es war aber eher ein Herrenhaus.
Mein Job: Praxishelfer
1990 kam ich nach Berlin zurück. Die Wiedervereinigung ohne mich? Das wollte ich mir hier unbedingt ansehen. Ich traute mich zum zweiten Mal, denn nach drei Jahren in Sarlat waren Silwa und ich geschiedene Leute, das prachtvolle Haus verkauft. Meine neue Partnerin hatte hier eine eigene Praxis, sie war Kinderärztin. Mein Job: Praxishelfer. Nach drei Jahren war auch hier Schluss. Silwa trat wieder in mein Leben – rein geschäftlich. Sie führte einen Laden in der Goltzstraße.
Ich war nur auf Achse, holte aus Frankreich ausgefallene Objekte, die hier nur wenige hatten. Die Kenntnis von Land und Leuten half beim Einkauf.
Heute ist der Antiquitätenhandel für mich eine Periode, die abgeschlossen ist. Ich kann es aber nicht lassen, gelegentlich noch über Flohmärkte zu gehen.
Mein Freund profitiert in seinem Geschäft davon, wenn ich manchmal Jugendstilobjekte entdecke. Gekauft wird aber sehr zurückhaltend. So schöne Bronzefiguren, wie ich sie einst selbst für nur zehn Mark verhökerte, sind leider kaum noch zu entdecken.
Mein Leben heute ist geprägt von ehrenamtlicher Arbeit für die orthodoxe Synagoge in der Joachimsthaler Straße – nicht nur bei der gewissenhaften Beschaffung des Fleisches. Ich gehöre den Stammbetern an, mindestens vier- bis fünfmal wöchentlich. Das Umfeld mit Freunden, Bekannten und Kollegen hat sich radikal geändert, viele sind nicht mehr am Leben. Die Synagoge und ich, wir brauchen uns.
Aufgezeichnet von Frank Toebs