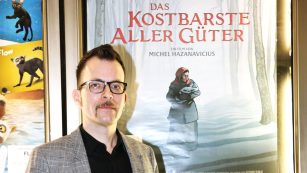So manche Familienlegende wird von Generation zu Generation weitergegeben, wodurch sie im Laufe der Zeit immer mehr an Strahlkraft gewinnt. Anderes hingegen wird oftmals verschwiegen – bis die Nachfahren eines Tages vielleicht durch Zufall davon erfahren. Bei Annette Leo, die in einer kommunistischen Familie mit jüdisch-deutschen Wurzeln in der ehemaligen DDR aufwuchs, war nichts davon der Fall.
»Bei uns ist weder etwas verschwiegen noch total verklärt worden. Die Tatsache, dass meine beiden Großväter jüdischen Familien entstammten und mein Großvater mütterlicherseits, Dagobert Lubinski, zunächst ein überzeugter Kommunist und Journalist war, genau wie später auch mein Vater Gerhard Leo, war nie ein Tabu«, sagt Leo. Dass ihr Großvater in Auschwitz ermordet wurde, habe sie immer gewusst. Es war die Verfolgungsgeschichte der Familie, die Annette Leo von früh an beschäftigte und deren Aufarbeitung sie sich später als Journalistin und auch als Historikerin verschrieb.
Sozialdemokratie Ihr Vater, der Journalist, Autor und Résistance-Kämpfer Gerhard Leo, floh mit seiner Familie bereits 1933 von Berlin nach Paris. Da war er gerade einmal zehn Jahre alt. Schon sein Vater Wilhelm Leo kam aus einer assimilierten jüdischen Familie. Er war Sozialdemokrat und in der Weimarer Republik als Rechtsanwalt tätig. In Paris war Wilhelm Leo Mitbegründer des Nationalkomitees Freies Deutschland für den Westen.
Dass ihr Großvater in Auschwitz ermordet wurde, hat sie gewusst.
Nach dem Einmarsch der Wehrmacht führte der Weg des jungen Gerhard Leo zunächst in den noch unbesetzten Süden Frankreichs, wo er sich 1942 schließlich dem französischen Widerstand anschloss. »Einige Male entkam er dabei nur knapp den Razzien der Nationalsozialisten«, sagt Annette Leo.
Viel habe ihr Vater über diese Zeit erzählt. Es waren spannende Geschichten. »Nach dem Krieg haben sich meine Eltern in Düsseldorf bei der Kommunistischen Parteizeitung ›Freiheit‹ kennengelernt, wo beide damals Volontäre waren. Dort haben sie sich ineinander verliebt und schließlich geheiratet«, erzählt Leo.
Journalismus Aus Überzeugung gingen beide in die DDR, gründeten eine Familie und bekamen drei Töchter. Annette Leo, die Erstgeborene, trat zunächst in die Fußstapfen des Vaters.
Nach dem Abitur 1966 wurde sie Journalistin, genau wie später ihr ältester Sohn, Maxim. 1968, nach dem Volontariat bei der »Berliner Zeitung«, studierte sie bis 1973 Geschichte und Romanistik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Neben dem Volontariat galt es, ein Fach zu studieren, um eine spezielle Kompetenz zu erwerben. »Und das war für mich die Geschichte.«
Doch zurück zu ihrem Vater Gerhard Leo, dem Autor des Erlebnisberichts Frühzug nach Toulouse. Ein Deutscher in der französischen Résistance wurde zum angesehenen Autor und Journalisten, während Mutter Nora die drei Töchter großzog und als Sekretärin arbeitete. »Sie hatte die gleiche journalistische Ausbildung, doch sie hat sich zeitlebens nicht so viel zugetraut.«
mutter Annette Leo hat ihre Mutter als zurückhaltende Frau in Erinnerung. »Als ich jung war, habe ich manchmal gedacht, sie soll sich doch mal ein bisschen zusammenreißen. Erst später habe ich begriffen, was das mit einem macht, wenn der Vater von den Nazis verfolgt und ermordet wurde.«
Ihre Mutter, Jahrgang 1922, war 20 Jahre alt, als ihr Vater starb. Ihre ganze Kindheit habe im Schatten der Verfolgung gestanden. Auch den Prozess habe sie miterlebt, die Besuche im Zuchthaus, das alles habe sie geprägt. »Unter den Nationalsozialisten galt sie als ›Mischling ersten Grades‹.« Daher musste sie vorzeitig die Schule verlassen, und es kam immer wieder zu Problemen mit diversen Arbeitsstellen. »Wenn die Gestapo sich dort gemeldet hat, war’s vorbei, dann wurde sie entlassen.«
Manchmal habe ihre Mutter auch von ihren Großeltern erzählt, die orthodoxe Juden waren. »Sie stammten aus Breslau, und die hat sie als Kind noch besucht«, sagt Leo. Doch bereits im Alter von 17 Jahren war Sohn Dagobert Lubinski aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten, um daraufhin in die sozialdemokratische Partei einzutreten.
religion Obwohl selbst mit der jüdischen Religion und Kultur aufgewachsen, habe er seinen Kindern nichts mehr davon vermittelt. »Er hat in allen Formularen, die ich gesehen habe, immer geschrieben: ›mosaisch, Dissident‹. Er war also der Meinung: Er ist weg davon«, sagt Annette Leo. Welche Rolle die Erziehung in der DDR gespielt habe, darüber muss Annette Leo nicht lange nachdenken.
»Schon im sozialistischen Sinne, in patriotischer Treue zur DDR als dem besseren Deutschland. Ich habe diese Erziehung natürlich erst einmal voll inhaliert und verinnerlicht.« Die Haltung ihrer Eltern war maßgeblich von der eigenen Verfolgungsgeschichte geprägt. Welcher Ernst dahinter stand, sei ihr erst viel später klar geworden, als sie selbst längst eine kritische Haltung eingenommen hatte.
Ihre Eltern, die Leo als recht kritisch bezeichnet, hatten sich sehr bemüht, sich weitgehend mit der DDR zu identifizieren. »Weil sie die DDR als eine Art Schutzwall gegen den Antisemitismus und gegen die Verfolgung betrachteten.« Was ja so nicht ganz stimmte, wie man wisse.
Spuren des Landes, in dem Leo aufwuchs, sind bis heute zu finden.
Spuren des Landes, in dem Leo aufwuchs, sind bis heute zu finden. An der Greifswalder Straße im Prenzlauer Berg zum Beispiel. Dort steht das 1986 fertiggestellte Ernst-Thälmann-Denkmal. Bestrebungen, das 14 Meter hohe Denkmal abzureißen, gab es viele. Annette Leo aber ist dagegen. Lange engagierte sich die Historikerin für den Erhalt. »Weil ich gegen die schnelle Entsorgung der Spuren und Zeichen der DDR-Vergangenheit bin. Stattdessen finde ich die Auseinandersetzung wichtig.« Letztlich wurde das Denkmal sogar unter Denkmalschutz gestellt, »und im vergangenen Jahr wurde endlich die lange geforderte künstlerische Kommentierung des Denkmals zuzüglich einer historischen Begleit-Erklärung umgesetzt«. In ihren Augen ein Erfolg.
Gruppe Wie hielt es die Familie eigentlich mit der Religion? »Ganz und gar atheistisch«, sagt Leo. Andererseits sei der Marxismus ja auch eine Art von Religion. Hat sie jemals die Spiritualität gesucht? »Ich habe eher Fragen gestellt und versucht, Orte zu finden, wo sie mir beantwortet werden könnten.« Aus großer Neugier habe sie schließlich 1986 die Gruppe »Wir für uns« der Ost-Berliner jüdischen Gemeinde aufgesucht. »Ich war damals total neugierig, und wir sind dort auch in allen jüdischen Feiertagen und Riten unterwiesen worden.«
Ausgelöst habe es in ihr indes nichts. »Viele von dieser Gruppe sind anschließend tiefer in die Religion eingestiegen, aber ich wollte das nicht.« Für sie sei das Judentum aber eine wichtige Hilfe gewesen. Bei der Suche nach den eigenen Wurzeln.