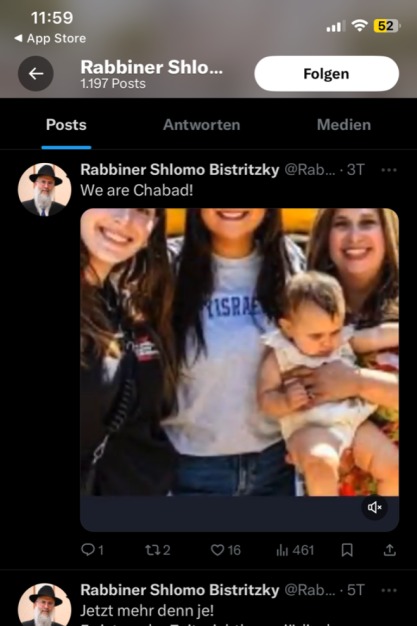Die jüngsten Entwicklungen in Syrien, ein Treffen der Chabad-Rabbiner in New York oder die Antwort auf die Frage, welches Wort mit dem hebräischen Buchstaben »Schin« geschrieben wird – die Tweets und Posts von Rabbinerinnen und Rabbinern sind definitiv aktuell, oftmals aufrüttelnd, ab und zu auch mal persönlich oder zumindest recht privat.
Trotz aller Kontroversen, die es um den Kurznachrichtendienst, der vor über zwei Jahren von Elon Musk übernommen und von »Twitter« in »X« umbenannt wurde: Dort nicht vertreten zu sein, ist für viele keine Option.
»Ein Rabbiner muss heute auch in den sozialen Medien aktiv sein, weil er mit seiner Gemeinde, mit der jungen Generation in Kontakt bleiben muss«, sagt Rabbiner Shlomo Bistritzky, der es als Landesrabbiner von Hamburg und auch persönlich ein bisschen als seine »Pflicht« ansieht, auf diesem Weg Einblick in Themen und Debatten in der jüdischen Gemeinschaft zu geben.
Gerade jetzt, »wo wir Juden unter Antisemitismus und Vorurteilen leiden, ist es wichtig, korrekte und wahre Informationen über das Judentum und das jüdische Leben zu geben«, betont Bistritzky, der unter dem Namen »RabbinerB« auf X postet.
Aus dem Alltag eines Rabbiners zu berichten, ist für viele Nutzerinnen und Nutzer interessant.
Mit mehr als 6700 Followern erreicht Bistritzky nicht nur Journalisten und Organisationen aus der jüdischen Community, sondern auch Privatpersonen mit einfachem X-Account, die vielleicht etwas aus dem Alltag eines Rabbiners erfahren wollen.
Dass die Plattform kein einfacher Ort ist, das ist dem Landesrabbiner klar. Aber das, so betont er, gelte insgesamt für die Sozialen Medien. Sie seien ein »schrecklicher Ort für Antisemitismus. Es gibt dort mehr Judenhass als auf den Straßen Deutschlands«, findet der Rabbiner, der überzeugt ist, dass Deutschland oder Europa auch Leute bestrafen sollte, »die sehr schlimme antisemitische Äußerungen machen«. »Es gibt viele Hasskommentare, aber ich ignoriere sie« – Resilienz, die manch andere nicht haben und deswegen X oder auch Instagram oder Facebook verlassen haben.
Bistritzky bleibt. Rabbiner Shlomo Afanasev auch: »Auf jeden Fall!«, sagt er. »Das bedeutet nicht, dass ich alles unterstütze, was X macht. Aber ich finde, weggehen ist einfach aufgeben. Das sollte man gerade in dieser Zeit nicht tun. Denn die, die Unwahrheiten verbreiten, bleiben ja.«
Generell nutzt Militärrabbiner Shlomo Afanasev Social Media oft und gern. Neben X hat er einen Account bei Facebook und Instagram. TikTok habe er zwar auch zweimal probiert, »das ist gar nicht meins«, stellte er nach kurzer Zeit fest. Was er postet, macht Afanasev von der Plattform abhängig. »Bei Facebook poste ich hauptsächlich jüdische Inhalte. Etwa den Wochenabschnitt oder etwas, das ich beruflich mache.«
»Muss jeder wissen, dass ich gerade nicht zu Hause bin?«, fragt Rabbinerin Yael Deusel
Bei X geht es ihm mehr um Politik und Israel. »Das mache ich erst seit dem 7. Oktober 2023, weil ich gemerkt habe, wie viel Wahnsinn und wie viele Unwahrheiten dort verbreitet werden. Im deutschsprachigen Raum gibt es leider nicht so viele Kanäle und Influencer, die sich wirklich mit Israel beschäftigen. Wer wissen will, was der Rabbiner manchmal kocht, wohin er reist oder auf welcher Veranstaltung er ist, der ist bei seinem Instagram-Account richtig.
Drucker Nicht für jeden ist das legere Posten von schönen Momenten im Urlaub oder aufregenden Reisen etwas. Rabbinerin Yael Deusel zum Beispiel hält davon gar nichts. »Natürlich muss jeder selbst wissen, was er wie über sich teilt und veröffentlicht lesen möchte, aber man sollte sich fragen: Gehen meine Urlaubsbilder wirklich jeden etwas an? Muss jeder wissen, dass ich gerade nicht zu Hause bin?« Ist Rabbinerin Deusel da einfach etwas übervorsichtig oder hat sie einen Punkt?
»Weggehen, das heißt aufgeben. Ich bleibe bei X.« Rabbiner Shlomo Afanasev
Die Medizinerin aus Bamberg erzählt, dass es nicht etwa nur Ältere sind, die ihr Leben nicht überall teilen wollen und der übermäßigen Nutzung von Smartphones und allem, was dazugehört, bewusst einen Riegel vorschieben: »Auch unter meinen Studierenden gibt es einige, die sagen: Wir gehen einen anderen Weg.«
Was Rabbinerin Deusel ganz allgemein stört, ist die Entwicklung der Kommunikation im öffentlichen Leben: »Gerade vorhin war ich mit dem Bus unterwegs. Niemand unterhält sich mehr. Nicht mal Leute, die gemeinsam einsteigen. Jeder packt sein Kästchen aus und ist damit beschäftigt, und das ist etwas, was ich für mich selbst nicht so gern haben möchte. Wenn ich kommuniziere, dann gern mit einem Gegenüber live oder eben am Telefon«, sagt Deusel. WhatsApp, das nutze sie, aber eher für eine kurze Kommunikation innerhalb der Gemeinde. Wer die Rabbinerin erreichen möchte, der ruft an oder schreibt eine E-Mail.
Die kann man seit 28 Jahren auch an die Jüdische Gemeinde Chabad Berlin senden, wie es aus dem Büro von Rabbiner Yehuda Teichtal heißt. Nach den Anfängen mit Mailings und Newslettern, ist Chabad heute natürlich auch in den Sozialen Medien vertreten: »Social Media ist ein unverzichtbares Werkzeug, um eine breite und diverse Zielgruppe zu erreichen«, sagt Rabbiner Teichtal. Es sei »die Kommunikationsform unserer Zeit und besonders effektiv, um mit der jungen Generation sowie mit Menschen in Kontakt zu treten, die wir physisch nicht erreichen können.«
»Wir wissen, dass Social Media oft missbraucht werden.« Rabbiner Yehuda Teichtal
Das Feedback auf die Message, dass »jeder Mensch ein Botschafter des Lichts sein kann – mit der Verantwortung, seine Umgebung positiv zu gestalten«, sei überwältigend, findet Teichtal. »Man muss aber auch deutlich sagen, dass es nicht immer positiv ist. Wir wissen zudem, dass Social Media oft missbraucht werden, um negative Botschaften zu verbreiten, und sehen, dass dies leider gelingt. Doch gerade das bestärkt uns darin, Soziale Medien zu nutzen, um das Gute zu fördern.«
Dass dazu auch der Dialog zählt, ist Rabbiner Shlomo Bistritzky ein Anliegen. »Wenn es in den Kommentaren um inhaltliche Fragen geht, kläre ich gern auf«, sagt er. Auf seinen Post zum Treffen von Chabad-Rabbinern habe er beispielsweise eine Frage bekommen, die er in den Kommentaren auch beantwortet habe. User wollten wissen, wo denn die Frauen waren. »Da dachte ich, ich sollte etwas dazu schreiben. Ich habe geschrieben, dass es im Februar auch eine Frauenkonferenz gibt, wo dann die Männer bei der Familie bleiben, es geht um Rabbiner, die Familien mit Kindern haben, und abwechselnd muss ein Elternteil bei ihnen zu Hause bleiben.« Frage beantwortet, alles geklärt.
Länder wie Australien und Schweden befürworten eine Altersgrenze für Soziale Medien.
Vielleicht ist das die Ausnahme in der Kommunikation auf X. Denn HassPosts, Mobbing oder schlimmste Beleidigungen sind traurigerweise schon fast normal in den Sozialen Medien. Gerade Kinder und Jugendliche sind Opfer von verbalen Attacken, die auch schon in körperlichen Angriffen resultierten.
Auch aus diesem Grund befürworten Länder wie Australien und Schweden eine Altersgrenze für Soziale Medien. Afanasev unterstützt das: »Das ist schon ein richtiger Schritt. Was und ab welchem Alter kontrolliert werden sollte, muss die Politik entscheiden. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter nur beschränkten Zugang dazu haben. Meine Kinder zum Beispiel haben kein Social Media. Und solange sie das nicht brauchen, werde ich es auch nicht zulassen.«
Für Rabbinerin Deusel hat eine Alterskontrolle bei den Sozialen Medien ihre Vor- und Nachteile. »Wie soll man das Alter der Nutzer denn nachweisen? Ich denke, dass es ein allgemeines Nachdenken über das, was bei Sozialen Medien passiert, geben muss«, lautet ihr Appell.
Und solange es dann vielleicht zehn Fakten zu Chanukka sind oder ein Post über die Stärke und den Zusammenhalt in dunklen Zeiten, öffnen Soziale Medien Türen. Dass Unternehmen wie Meta oder X Türhüter stellen, um die, die Hass verbreiten, abzuweisen, dafür bedarf es realistischerweise wohl eines Wunders.
(Mit Helmut Kuhn und Christine Schmitt)