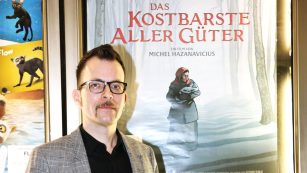Eigentlich wollte ich immer schreiben. Dass ich allerdings einmal zum Theater kommen würde, als Regisseurin und Autorin, das hatte ich damals nicht erwartet. Es ist nun über 20 Jahre her, dass ich 18-jährig zu einem Tag der Offenen Tür an der Universität Tel Aviv ging. Gedichte – die wollte ich einmal zu Papier bringen, mehr wusste ich nicht. Keine Ahnung, wie oder warum. In einem Beratungsgespräch erklärte man mir dann nüchtern, dass das keine Möglichkeit sei. Dafür aber wurde mir die Theaterfakultät empfohlen, ein Studiengang mit dem Titel »Schauspiel und Schreiben«.
Nein, begeistert war ich nicht; immerhin hatte ich bis dahin wirklich gar keine Beziehung zum Theater. »Geh hin! Versuch es mal!«, entgegnete man mir, und ich ließ mich breitschlagen, nahm an einer Probe teil, und dann passierte, womit ich nie gerechnet hätte: Ich verliebte mich. In die Bühne und das ganze Drumherum. Wir, das heißt, die angehenden Studenten, durften alleine eine Szene gestalten. Ich übernahm die Regie.
Das war der Anfang. Tatsächlich war die Bühne im Laufe meines Studiums dann nicht mehr so wichtig. Die meiste Zeit saß ich in der Bibliothek. Ich hing immer noch der Poesie nach, trotz meiner Begeisterung fürs Theater. Mein Studium war fortan eine Art Quelle für Lesezeichen für die Zukunft: Ich nahm alles auf, was ich kriegen konnte.
sprache Vor Studienbeginn lebte ich mit meinen Eltern in Jerusalem. Geboren wurde ich in Raanana, einer Kleinstadt bei Tel Aviv, aus der meine Eltern mit mir, als ich noch ein kleines Kind war, aus beruflichen Gründen weggezogen waren. Meine Jugendjahre verbrachte ich also in Jerusalem, schloss dort die Schule ab, zog nach Tel Aviv, wo ich den bisher größten Teil meines Erwachsenenlebens verbrachte, und ging dann noch einmal für eineinhalb Jahre zurück, ich hatte mein Jerusalem-Comeback. Ich nahm dort ein Studium an der »Hochschule für Visuelles Theater« auf.
Das war mir wichtig, denn zu jener Zeit war klar, dass ich Regie führen wollte. Das Theater betrachtete ich aus einer visuellen Perspektive: Körper waren mir wichtiger als Wörter. Das ist interessant, denn hier, in Berlin, wo ich seit mittlerweile sechs Jahren lebe und wo ich »keine Sprache habe«, das heißt, wo ich nicht von meiner Muttersprache umgeben bin, kehre ich zurück zum Wort. Hier schreibe ich bloß, führe keine Regie mehr.
Wieso ich ausgerechnet nach Berlin gezogen bin? Schließlich habe ich keine deutschen Vorfahren wie viele Israelis, die hier leben. Ich wusste nicht viel über das Deutschland von heute, kannte die Sprache nicht; der einzige Satz, den ich auf Deutsch sagen konnte, war: »Arbeit macht frei«.
Die komplizierte deutsch-israelische Geschichte hat mich nicht abgeschreckt. Ich habe mir einfach nicht so viele Gedanken gemacht, ich wollte in erster Linie weg aus Israel. Als ich als junge Frau an die Uni kam, wusste ich auch nicht so recht, warum ich dahin gekommen bin. Ähnlich verhält es sich mit meinem heutigen Lebensmittelpunkt. Ich glaube, manchmal entscheidet das Leben einfach für mich.
raum In Israel war ich an ein Ende gekommen, persönlich, politisch, professionell. Ich spürte, dass für mich alles kleiner und kleiner wird, das heißt, mein persönlicher Raum. So nenne ich das jetzt einmal. Ich arbeitete damals hart als Regisseurin, ging bis an meine Grenzen und spürte, dass es an der Zeit war, einmal innezuhalten. Ich wollte nicht nach Berlin, weil die Lebenshaltungskosten hier niedriger sind als in Tel Aviv oder weil der Joghurt billiger ist. Ich glaube, ich war einfach neugierig auf diese Stadt und wollte herausfinden, was ich mit meinem Beruf in Berlin so alles anstellen kann. Als ich ankam, hatte ich keinen Job, keine Aufträge, aber Freunde. Das ist viel wichtiger.
Grundsätzlich haben Regisseure oder Theaterautorinnen es nicht leicht, etwas Festes zu finden, der Beruf ist mit vielen Hürden und Anstrengungen verbunden. Was allerdings ein riesiger Vorteil ist: Ich kann ihn überall, an jedem Ort, ausüben. Also habe ich meine Koffer gepackt.
Der politische Beweggrund für meinen Wegzug aus Israel ist der: Ich wollte meine Meinungen über und meine Perspektiven auf den Nahostkonflikt hinterfragen. Ich denke, dass es wichtig ist, wenn man in einem Land lebt, das auch eine Besatzungspolitik ausübt, einmal einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Was sehe ich von dem Punkt aus, an dem ich stehe? Aus der ersten Reihe sieht man etwas anderes als aus der letzten.
Heute kann ich sagen, dass meine Perspektive sich geändert hat. Meine Meinung ist vielschichtiger geworden, aber nicht unbedingt so, wie ich es erwartet habe. Als ich herkam, dachte ich, dass Berlin der Ort des Aufschreis sei, der Ort, an dem, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, besonders deutlich Kritik an israelischer Politik geübt wird. Allerdings ist es alles etwas komplizierter. Mir wurde bewusst, wie komplex diese Themen hier diskutiert werden, alles, was einen Bezug zu Israel hat. Das sind sensible Themen.
dialog Wenn ich heute mit meinem Publikum in einen Dialog trete, frage ich mich immer, wie wir kritisch gegenüber einer bestimmten Politik sein können, zum Beispiel der israelischen, ohne dabei zu hassen, ohne antisemitisch zu sein. Kritik ist wichtig, notwendig, sie darf aber nicht in Hass umschlagen. Wir dürfen uns nicht vollends auf eine Seite stellen, damit wir den Blick für die andere Seite nicht verlieren.
Noch ein Bild, das ich von Berlin hatte, hat sich geändert. Vor Jahren, als ich noch nicht hier lebte, reiste ich einmal durch die Stadt. Ich war sofort begeistert, hatte ein gutes Gefühl, was diesen Ort angeht. Es gibt in Berlin eine Art von Fürsorge und Vorsicht, auch ein Kümmern, das ich als posttraumatisch beschreiben würde. Für mich folgte daraus ein Gefühl von Sicherheit. Berlin war gewaltfrei.
Erst als ich hergezogen bin, einige Jahre hier gelebt hatte, merkte ich, dass natürlich auch die deutsche Gesellschaft eine Gesellschaft der Gewalt ist. Ich verstand ja anfangs die Sprache nicht, da wirkte alles so still auf mich. Erst als ich auch sprachliche Nuancen verstand, sah ich die Gewalt. Dieser Ort ist keineswegs ideal. Anfangs sind wir begeistert wie Kinder, wenn wir etwas nicht verstehen, und werden erst mit der Zeit erwachsen.
minderheit Heute werde ich auch mit den dunklen Seiten der deutschen Gesellschaft konfrontiert: Das ist weiße, männliche Gewalt, Rassismus, Antisemitismus, ein Gefühl von Überlegenheit, die Art, wie jemand mit einem Menschen spricht, der auf der Straße um Geld bittet, oder jemand, der eine Frau vom Fahrrad stößt, bloß weil sie auf dem Fußweg gefahren ist.
Oder ich nehme einen Mann wahr, der einen anderen hasserfüllt ansieht, nur weil dieser eine andere Sprache spricht. Das sind alles Dinge, die ich am Anfang nicht gesehen habe; ich lerne immer noch diese Gesellschaft mit ihren vielen übereinanderliegenden Schichten kennen.
Sicher, das sind keine Probleme, die ich nur in Deutschland sehe. Aber hier lebe ich nun einmal. Als israelische Frau bin ich immer in der Minderheit und mache mir Sorgen, vereinnahmt zu werden. Bestimmte Gruppen, Juden oder Muslime, werden schnell objektiviert. Darauf habe ich keine Lust. Für jemanden wie mich gibt es immer einen Körper, der in einem Raum arbeitet. Alles, was ich sage, findet also erst einmal im Raum Deutschland statt. Ich kann nicht über Situationen woanders sprechen. Mein Körper ist hier. Ich schaue mir Berlin an, dann Deutschland und später andere Orte. Ich arbeite mich von innen nach außen vor.
sicherheit Die meisten Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, arbeite oder privat zusammen bin, stammen aus gesellschaftlichen Randgruppen. Liberalismus, Toleranz, Demokratie hin oder her – diese Leute haben es in einer männlichen und weiß dominierten Gesellschaft immer noch schwer. Sie brauchen eine Stimme. Auch deswegen mache ich Theater.
Es ist aber nicht so, dass ich mich in Berlin und Deutschland nicht wohlfühlen würde, vor allem fühle ich mich hier immer noch sicherer als an vielen anderen Orten. Die politische Atmosphäre ist trotz der Wahlerfolge der AfD nicht so angespannt wie woanders. Dass ich mich hier nach wie vor wohlfühle, liegt vielleicht auch daran, dass ich emotional nicht so stark mit Deutschland verbunden bin – noch nicht. Ich bin nicht so schnell beleidigt und fühle mich auch nicht so schnell angegriffen. Ob sich das ändert? Das könnte schon sein. Erst einmal bin ich hier. Und ich habe nicht vor, wegzuziehen.