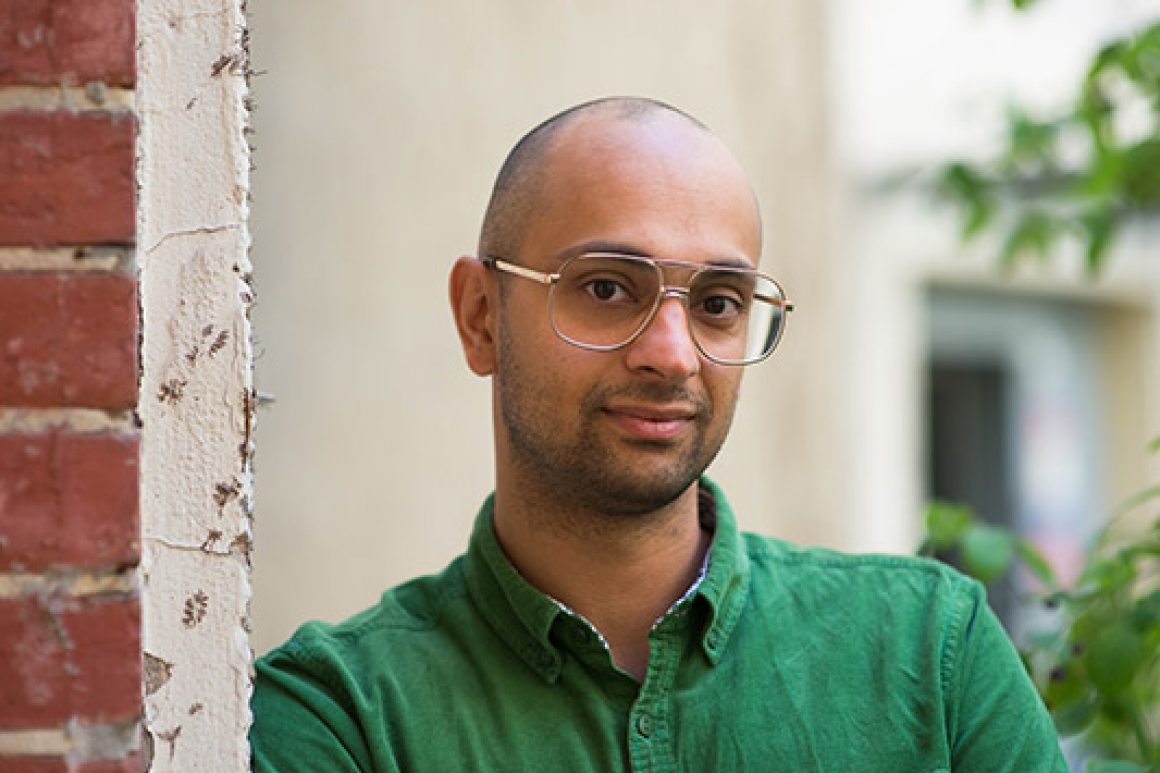Als Sascha Vajnstajn in den 90er-Jahren mit seiner Familie aus der Ukraine nach Deutschland kam, wohnte er übergangsweise in einem Auffanglager am Essener Stadtrand. Der fünfjährige Junge spielte damals meistens mit dem Kind der libanesischen Nachbarsfamilie, Achmed. Die beiden verstanden sich prächtig, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch kein Wort Deutsch sprachen – und sich nur mit Händen und Füßen verständigen konnten.
Später dann, als Saschas Familie nicht mehr im Auffanglager wohnte, trafen die beiden sich zufällig auf dem Spielplatz wieder. Doch von der alten Sandkastenfreundschaft war nicht mehr viel übrig geblieben. »Du Scheißjude, gib uns unser Land zurück«, hieß es jetzt auf einmal.
Auch knapp zwei Jahrzehnte später merkt man Sascha noch das Unverständnis über diese Begegnung an. »Es ist schon absurd, was Ideologie mit einem Menschen so machen kann«, sagt der heute 28-Jährige nachdenklich, nachdem er eine kleine Weile geschwiegen hat.
Trotzdem möchte er die Geschichte nicht einfach so für sich stehen lassen, seine Erfahrungen mit Muslimen sind durchaus ambivalent: »Gleichzeitig hatte meine Familie auch einen guten palästinensischen Freund, der, anders als dieser libanesische Junge, direkt aus dem Zentrum des Konflikts stammte, der dort Angehörige verloren hatte, den es aber nie kümmerte, ob wir nun Juden sind oder nicht«, erzählt Sascha.
Anschläge Diese Situation kennen viele junge Juden in Deutschland. Einerseits hat man eigene Erfahrungen mit muslimischem Antisemitismus gemacht oder davon aus dem Bekanntenkreis erfahren. Gleichzeitig gibt es aber auch gute Kontakte mit Muslimen – manche Juden teilen deren Migrationserfahrung.
Und dann ist die Bedrohung durch islamistischen Terror in den vergangenen Monaten immer präsenter geworden: »Durch solche Anschläge wie die in Paris oder Brüssel, die sich gezielt gegen jüdische Einrichtungen richten, merkt man schon, dass es irgendwie näher kommt, auch wenn es momentan noch abstrakt bleibt«, findet Sascha Vajnstajn.
Zusammen mit knapp 30 weiteren Mitgliedern jüdischer Gemeinden in ganz Deutschland nahm der Sozialarbeiter aus Essen am vergangenen Wochenende an einem Seminar teil, das vom Internationalen Büro der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) in Berlin organisiert wurde. Unter dem Titel »Islamisierung in Europa?« diskutierten die Teilnehmer über Gefahren, die für jüdisches Leben in Deutschland und Europa aus Antisemitismus und Fundamentalismus entstehen.
ZWST-Projektleiterin Sabine Reisin nannte als Impuls für die Veranstaltung vor allem die Pegida-Demonstrationen im vergangenen Winter, die zunehmende rechtspopulistische Vereinnahmung der Debatte um die Gefahren islamistischer Gewalt, aber eben auch die Frage nach der tatsächlichen Bedrohung: »Uns war es vor allem wichtig, die richtigen Informationen von den falschen zu trennen – also zu zeigen, welche Gefahren real sind und welche auf Vorurteilen beruhen«, sagt Reisin. Sie habe außerdem das Gefühl gehabt, dass bei den jüngeren Gemeindemitgliedern der Bedarf bestanden hätte, diese Fragen zu diskutieren.
Das Programm wurde der Vielschichtigkeit der Thematik gerecht und diskutierte neben der Bedrohung durch Antisemitismus und Fundamentalismus auch die Frage des Dialogs zwischen Juden und Muslimen. Fachleute zu Fragen des islamischen Extremismus waren ebenso anzutreffen wie Vertreter interreligiöser Organisationen.
IS Unter anderem berichtete der ehemalige ARD-Korrespondent Jörg Armbruster über die Ausbreitung des »Islamischen Staats« (IS) im Nahen Osten und welche Faktoren diese begünstigen. Eine Gefahr für Israel, die aus der zusammenbrechenden Ordnung der Region resultieren könnte, wollte der Journalist aber mittelfristig nicht erkennen: »Israel ist gut gerüstet, verfolgt die Rolle der Hisbollah im syrischen Bürgerkrieg aber mit Sorge«, schätzte er die Lage ein.
Dass die Wahrnehmung der Bedrohung durch islamischen Antisemitismus unter den Teilnehmern sehr unterschiedlich ausfallen konnte, zeigte sich im Verlauf des Wochenendes. Anastasia Perebeinos zum Beispiel ist 26 Jahre alt und wuchs in Bamberg auf, wurde aber in Moldawien geboren. Die junge Wirtschaftsstudentin begann erst vor kurzer Zeit, sich mit ihrer jüdischen Identität auseinanderzusetzen, und suchte deshalb den Kontakt zu ihrer Heimatgemeinde.
Während sie früher ihre Herkunft verschwieg, geht sie heute offener damit um. Als sie kürzlich nach Israel reiste, postete sie auf Facebook ein Foto von sich in der Negevwüste mit dem kleinen Zusatz Hashtag »Israel«. Nur wenige Augenblicke später antwortete ein entfernter Bekannter mit Hashtag »Palestine«, und eine hitzige Debatte entbrannte um ein harmloses Urlaubsfoto – alles auf Anastasias Pinnwand. Seitdem ist sie wieder vorsichtiger geworden, was sie von ihrer Herkunft preisgibt.
Ausgrenzung Trotzdem will sie sich nicht nur auf Antisemitismus von Muslimen konzentrieren: »Für mich steht eher die psychologische Komponente im Vordergrund. Viele junge Menschen wissen heute nicht, was sie machen sollen, sind übersättigt von zu vielen Toleranzreden und fühlen sich nicht integriert«, argumentierte Anastasia.
Deshalb glaube sie nicht, dass sich der Hass immer speziell gegen Juden richtet, sondern er sei vielmehr Ausdruck eines allgemeinen Gefühls der Ausgrenzung. Auch der arabisch-israelische Psychologe Ahmad Mansour, der einen Workshop zur Radikalisierung muslimischer Jugendlicher anbot, sprach diese Marginalisierungserfahrung an. Er ergänzte aber, dass dieser Faktor nicht als einzige Erklärung für Judenfeindschaft herangezogen werden darf, sondern auch andere Gründe eine Rolle spielen, die teilweise auch bereits im Mainstream-Islam angelegt seien.
Mansour nannte zum Beispiel die patriarchale Struktur in vielen Familien sowie den traditionellen Antisemitismus, der mit den Juden ein Feindbild liefert, das man einfach für alle Missstände verantwortlich machen kann. Der Staat müsse in Deutschland deshalb eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Tendenzen im Islam fördern und teilweise genauer hinschauen, wer sich hinter den islamischen Verbänden, mit denen er kooperiert, tatsächlich verbirgt. »Einer der Organisatoren des antisemitischen ›Al-Quds-Tags‹ in Berlin ist in Hamburg Teil des Staatsvertrags«, kritisierte Mansour.
Muslime In einer besonderen Situation ist der 36-jährige Düsseldorfer Barei Efraim Sawar. Das Mitglied im Düsseldorfer Gemeinderat hat neben bucharischen auch afghanische Wurzeln. In seiner Verwandtschaft gibt es einige Muslime. »Deswegen bin ich natürlich immer sehr darauf bedacht, nicht alle über einen Kamm zu scheren, merke aber auch im Alltag, dass viele Muslime entspannter mit mir umgehen, als wenn ich Aschkenase, also ein ›weißer Jude‹ wäre«, erzählte Barei.
Er selbst hat keine Erfahrungen mit speziell muslimischem Antisemitismus gemacht, kennt aber entsprechende Schilderungen von Bekannten – und findet deshalb, dass man auf diese Form zurzeit besonders achten muss.
»Muslimischer Antisemitismus ist im vergangenen Jahr salonfähiger geworden, weil er oftmals als Israelkritik abgetan wird. Wie zum Beispiel der Anschlag auf die Synagoge in Wuppertal, die ja direkt bei uns um die Ecke ist: Da wurde auch nur von ›Israelkritik‹ gesprochen und nicht von Antisemitismus.« Der Staat, findet Barei, muss nun endlich stärkere Antworten auf diese Probleme finden, als er das bisher getan hat.