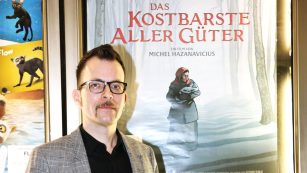Ihr Gesicht verrät Entzücken wie Staunen. »Wow! Und so sauber!«, ruft Mirjam Marcus, als sie zusammen mit ihrem Sohn Benjamin und Ehemann Mario das Foyer der W. Michael Blumenthal Akademie betritt und die Arche in ihrer Glasvitrine erblickt. Sie steht direkt vor der Bibliothek – als zeitgenössische kleine Schwester der großen ANOHA, der Arche der Kinderwelt im Jüdischen Museum Berlin.
»Benjamin hatte für seine Barmizwa die Arche Noah gelernt, um sie vorzutragen. Deshalb wollte ich eine kleine Arche für ihn anfertigen lassen. Ich hatte mir damals etwas aus Pappe vorgestellt, wie Mütter so etwas basteln würden. Wir fragten den damaligen Leiter des Jugendzentrums – und dann wurde es immer mehr«, sagt Mirjam Marcus.
Ein kleines Kunstwerk ist Uri Fabers Arche geworden. Einen Meter misst das vierstöckige hölzerne Schiff und ebenso viel bis zur Mastspitze. Darauf befinden sich, liebevoll angerichtet, Spielzeug-Tierpärchen von Pinguinen bis zu Elefanten, von Zebras bis zu Eisbären. Affen hängen an der Strickleiter, Tauben nisten auf dem Oberdeck, Noah wacht über seine Schützlinge. »Sind die Tiere alle von uns? Ich weiß noch, wie ich durch Berlin gelaufen bin, sie zu kaufen«, erinnert sich Mirjam Marcus.
WOCHENABSCHNITT Die Geschichte des gerade aufgestellten Objekts ist ein Stück Geschichte des Jüdischen Museums selbst – wie auch Zeugnis jüdischen Lebens in Berlin. Benjamin Marcus feierte im Oktober 1990 seine Barmizwa in der Synagoge am Fraenkelufer. Er hatte mit seinem Religionslehrer die Parascha Noach gelernt. Die Geschichte der Arche Noah würde er im Wochenabschnitt vortragen. Auf der Webseite des Museums ist jetzt ein Filmmitschnitt des Vortrags in der Synagoge zu sehen.
Zwei Trauungen der Familie fanden in der Synagoge am Fraenkelufer statt.
Die anschließende Feier fand im damaligen Jüdischen Museum im Martin-Gropius-Bau statt. Uri Fabers Werk und die Tiere von Mirjam Marcus wurden in der Rotunde aufgestellt. Blaue Tüten, gefüllt mit Süßigkeiten, symbolisierten das Meer.
URGROSSELTERN Die Leiterin der Jüdischen Abteilung des Berlin-Museums, Vera Bendt, integrierte die Feier kurzerhand in die Ausstellung – inklusive Puppentheatervorstellung, Eis essender und spielender Kinder. Das passte gut ins Konzept. »Das Museum wollte nicht nur jüdische Vergangenheit zeigen. Sondern es sollte auch gegenwärtiges jüdisches Leben stattfinden«, sagt die heutige Sammlungskuratorin Tamar Lewinsky.
Die Familie Marcus war und ist so vielfach verwoben mit der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, wie sie auch tief verwurzelt in ihr ist. Schon Mario Marcus’ Urgroßeltern waren Beter in der Synagoge am Fraenkelufer, erzählt er. Sein Großvater habe eine Apotheke sowie eine chemische Fabrik in Berlin betrieben und lebte in Mariendorf.
Beide Eltern wurden in Berlin geboren. Der Vater lebte in der Skalitzer Straße und gelangte 1938 über Italien nach Frankreich. Er blieb bis zur Besatzung in Paris, floh nach Nizza und illegal in die Schweiz. Nach der Befreiung arbeitete er bei der Agence Juive in Paris, der französischen Zweigstelle der Jewish Agency.
»Mein Großvater war vor der Deportation 1942 an einem Herzinfarkt gestorben, meine Mutter gelangte, ähnlich dem Kindertransport, 1939 nach England«, berichtet Mario Marcus. Sie wurde Kinderkrankenschwester in Nottingham. Ihre Eltern wurden im Konzentrationslager ermordet.
PARIS »Meine Eltern kannten sich schon in Berlin, die Familien waren weitläufig verwandt, und sie waren fast schon wie verlobt gewesen. 1947 ging meine Mutter nach Paris, dort heirateten sie.« Am 14. Mai 1948, »eine Stunde vor der Geburt Israels, kam mein Bruder zur Welt«, sagt Mario Marcus. Und drei Jahre später er selbst.
»Aber meine Mutter mochte das Leben in Frankreich nicht so sehr, mein Vater fühlte sich in England nicht wohl. Es stellte sich die Frage: ›Wie, wo leben wir weiter?‹« Schließlich ging eine Schwester des Vaters nach Ost-Berlin, »um das ›bessere Deutschland‹ aufzubauen. Großmutter ging nach West-Berlin und sammelte das ›arisierte‹ Vermögen wieder zusammen.«
Ein Großteil sei zurückerstattet worden. Die Familie kehrte nun zurück. »Vater arbeitete in der Immobilienwirtschaft und verwaltete einen Großteil der Liegenschaften der jüdischen Gemeinden. Sie bauten das Leben wieder auf, Vater das wirtschaftliche, Mutter das jüdische.«
Eng befreundet mit Ruth Galinski, rief sie 1953 den »Jüdischen Frauenbund« wieder ins Leben und war führendes Mitglied der Jüdischen Gemeinde. Mario Marcus studierte Medizin und wurde Gefäßchirurg. Er ist unter anderem im Vorstand des von Rabbinerin Gesa Ederberg gegründeten Vereins Masorti aktiv.
HOCHZEIT Mirjam Marcus kam 1953 in Berlin zur Welt. Ihr Vater betrieb ein Uhrengeschäft am Hermannplatz – »auch daher die Verbindung zur Synagoge am Fraenkelufer«. Sie studierte Judaistik und ist stark in der Jüdischen Gemeinde engagiert. Ihre Hochzeit fand in der Synagoge am Fraenkelufer statt. Filmaufnahmen der Trauung sind fester Bestandteil der Dauerausstellung des Jüdischen Museums. Sohn Benjamin lernte seine Frau in der Synagoge am Fraenkelufer kennen und heiratete auch dort. Er ist heute Kinderarzt.
Am Wiederentstehen jüdischen Lebens in der Stadt hat die Familie wesentlichen Anteil.
So schließt sich der Kreis zu Benjamins Barmizwa – und der in der Tora überlieferten Geschichte der Arche, zumindest sinnbildlich Gleichnis für die Entstehung neuen Lebens nach der Katastrophe. Am Wiederentstehen jüdischen Lebens in Berlin jedenfalls hat die Familie wesentlichen Anteil. Die Geschichte der Arche habe auch heute noch große Bedeutung für ihn, erklärt Benjamin Marcus – immerhin sei seine Frau eine geborene Noa.
Schließlich stand die von Mama Marcus in Auftrag gegebene Arche zunächst zu Hause auf dem Tisch und dann rund 30 Jahre in Papa Marcus’ Arbeitszimmer. »Die Kinder spielten nicht mehr richtig damit, sie waren schon zu alt dafür, und auf dem Schrank verstaubte sie ein wenig«, wie er zugibt. »Und genau dort habe ich sie vor Jahren entdeckt«, sagt Tamar Lewinsky. Als das Kindermuseum dann kam, habe sie darum gebeten, die Arche ausstellen zu dürfen – die Familie schenkte sie dem Museum. Vor sechs Monaten wurde sie abgeholt und restauriert.
»Es ist schön, dass wir jetzt auch ein gegenwärtiges Objekt als Bindeglied haben.« Benjamin blickt ein wenig wehmütig in die Vitrine. Mirjam Marcus neigt den Kopf. »Wenn es damals schon Playmobil gegeben hätte, wer weiß …?«