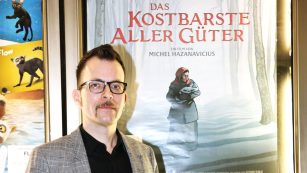Es sind unruhige Zeiten, in denen wir leben. Zeiten, in denen Dialogbereitschaft und die Fähigkeit, radikal anderen zuzuhören, verloren scheinen und Kugeln an die Stelle von Worten getreten sind.» Die verstärkte Polizeipräsenz vor den Türen des Pfalzbaus in Ludwigshafen schien den Worten recht zu geben, mit denen sich Eva Schulz-Jander an das Publikum im Theatersaal wandte.
Mit einem Appell gegen Antisemitismus und religiös motivierte Gewalt eröffnete die katholische Präsidentin des Deutschen Koordinierungsrats der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit am Sonntagmorgen die bundesweite Woche der Brüderlichkeit unter dem Motto «Im Gehen entsteht der Weg. Impulse christlich-jüdischer Begegnung».
«Mit Religion Feindbilder zu schaffen, spricht gegen die Religion. So wie wir Religion verstehen, lehrt sie uns genau das Gegenteil», betonte Schulz-Jander. Ein Verständnis, nach dem der katholische Theologe Hanspeter Heinz seit Jahrzehnten lebt und lehrt. Seit den 70er-Jahren setzt er sich für den christlich-jüdischen Dialog, für Aussöhnung und gegenseitige Achtung ein. Für seine Verdienste wurden er und der Gesprächskreis «Juden und Christen», den er seit mehr als 40 Jahren leitet, beim Festakt in Ludwigshafen mit der Buber-Rosenzweig-Medaille geehrt. In Erinnerung an die beiden jüdischen Philosophen vergibt der Koordinierungsrat der 83 Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Deutschland seit nunmehr 36 Jahren diese Auszeichnung.
Debatten Der Gesprächskreis des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ist ein weltweit einmaliges Gremium, in dem 15 Juden und 17 Katholiken regelmäßig zum Austausch zusammenkommen. Gemeinsam erarbeiten sie Positionen und Stellungnahmen, die international Beachtung finden und auch teils heftige Debatten auslösen.
Hanspeter Heinz, bis 2005 Professor für Pastoraltheologie an der Universität Augsburg, ist ein Mann der klaren Worte, die er auch ausspricht, wenn es um Geschichte und Verantwortung der eigenen Kirche geht. Intensiv hat er sich der Aufarbeitung antijüdischer Traditionen innerhalb der katholischen Kirche gewidmet. «An der Schoa», sagt Heinz, «trägt die Kirche erhebliche Mitschuld durch ihre Judenfeindlichkeit. Das hat dem Immunsystem der Kirche geschadet.» Als Theologiestudent in Rom war Hanspeter Heinz hautnah dabei, als die katholische Kirche 1965 im Zweiten Vatikanischen Konzil mit ihrer Erklärung «Nostra Aetate» mit der fast 2000-jährigen Tradition brach und sich zu ihrem geistigen Band mit dem Judentum und der Erwählung des Volkes Israel bekannte.
identität Es sei für ihn eine «frappierende Entdeckung» gewesen, «dass wir unsere christliche Identität weithin auf Kosten der Juden bestimmen, indem wir ihnen insgeheim eine theologische und ethische Minderwertigkeit attestieren», sagte Heinz. Mithin ein Grund, sich im Gesprächskreis «Juden und Christen» seit so langer Zeit zu engagieren und heftig auch öffentlich Kritik zu üben, etwa als 2008 der heute emeritierte Papst Benedikt XVI. die Karfreitagsfürbitte «Für die Bekehrung der Juden» in einem «vorkonziliaren» Geist neu formulierte.
Judenmission Im Jahr darauf löste der Gesprächskreis mit seinem «Nein zur Judenmission – Ja zum Dialog» erneut eine heftige innerkirchliche Debatte um die alte, aber immer virulente Frage aus, ob Juden Jesus als Messias anerkennen müssen, um zum Heil zu gelangen.
Wenn Hanspeter Heinz öffentlich zu diesen Fragen spricht, dann bricht sein rheinischer Dialekt hervor. «Wat soll dat», fragt er dann ins Publikum, «dass der Papst Gott Vorschriften macht, die sich nicht gehören?» Die Lacher hat er dann auf seiner Seite, auch beim Festakt zur Woche der Brüderlichkeit. Friedhelm Pieper, Evangelischer Präsident des Koordinierungsrats, lobt bei der Überreichung der Buber-Rosenzweig-Medaille Heinz’ «kluge und humorvolle Leitung» des Gesprächskreises. Er habe ein außerordentliches Talent, zu moderieren.
auszeichnung Das bescheinigt ihm auch Landesrabbiner Henry G. Brandt. Er nannte die Auszeichnung eine «große Freude und Genugtuung». Heinz sei ein streitbarer Bruder. «Er hat keine Angst anzuecken, und er ist ein Mensch mit einem enorm großen Herzen.» Der Preisträger selbst formulierte es wiederum in seiner typischen Art: «Ich bin Skorpion, ein ganz friedliebender Mensch. Nur ab und zu packe ich den Stachel aus.» Er freue sich, dass ihm die Auszeichnung vor allem Einladungen zu Vorträgen und Reden einbringe.
Vor dem Hintergrund der Attentate in Paris und Kopenhagen und auch der Kippa-Debatte in Deutschland gehe es ihm darum, «Wachsamkeit» zu fördern, aber keine Panik zu schüren. «Die Attentäter wollen gesehen werden, wir sollten sie aber nicht noch sichtbarer machen. Das ist kontraproduktiv.»
Sicherheitsverlust Dass sich für Juden in Deutschland wieder die Frage nach der Ausreise stellt und sie um ihre Sicherheit fürchten, wenn sie Kippa tragen, bezeichnete Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in seiner Laudatio in Ludwigshafen als «bedrückend und beschämend». Niemand dürfe sich an die «tägliche Realität der Bedrohung der Sicherheit von Juden in diesem Land gewöhnen». Niemand könne sich in einer Demokratie entspannt zurücklehnen, ohne mit Leidenschaft für die Überwindung von menschenverachtenden Ideologien wie Rassismus und Antisemitismus zu streiten. Die Preisträger der Buber-Rosenzweig-Medaille täten dies auf vorbildliche Weise, so Bedford-Strohm.
Malu Dreyer, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, betonte, «dass die jüdische Kultur ein bedeutender Teil unserer Heimat ist». Es dürfe nicht sein, dass Juden wieder zur Zielscheibe würden und viele an Ausreise dächten. «Wir lassen uns die Freiheit in unserem Land nicht durch Extreme bedrohen», appellierte sie. Die Woche der Brüderlichkeit bezeichnete Dreyer als beispielhaft für die Verständigung in der Gesellschaft. Der Dialog und die Versöhnungsarbeit der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit hätten «Maßstäbe für eine lebendige Erinnerungskultur gesetzt».
Der Festakt in dem Ludwigshafener Konzert- und Theaterbau, zu dem Oberbürgermeisterin Eva Lohse unter den Gästen auch den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, begrüßte, war der offizielle Auftakt zu den zahlreichen Veranstaltungen zum christlich-jüdischen Dialog im gesamten Bundesgebiet. Gespräche, Ausstellungen, Filme und Führungen in mehr als 80 Städten beschäftigen sich mit dem Jahresmotto.
Begegnungen In seinem Grußwort zur Veranstaltungsreihe in Berlin und Brandenburg betonte Israels Botschafter in Deutschland, Yakov Hadas-Handelsman, dass «Israelis und Deutsche, Juden und Christen» seit Jahrzehnten «nun schon einen Weg des Dialogs und der Verständigung» beschreiten. «Die Begegnung ist dabei elementar, denn gegenseitiges Verstehen braucht Begegnung», so der Botschafter. Ein ebenso permanenter wie ehrlicher Austausch sei dabei eine wichtige Voraussetzung.
Das bestätigten auch die Vertreter der Kirchen und Rabbinerkonferenzen nach einem Treffen am Montag in Ludwigshafen. Das Verhältnis zwischen Juden und Christen habe sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. In keinem anderen Land gebe es auf lokaler Ebene so enge Kontakte zwischen Christen und Juden, heißt es in einer Erklärung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) nach dem Gespräch mit der Allgemeinen und der Orthodoxen Rabbinerkonferenz. Die vertrauensvollen Beziehungen hätten sich auch in Konfliktphasen bewährt.
Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm und der katholische Aachener Bischof Heinrich Mussinghoff verwiesen auf die gemeinsame Verantwortung der Kirchen, sich öffentlich gegen Antisemitismus zu stellen und in Schulen über alte und neue Formen des Judenhasses aufzuklären. Die Ergebnisse des christlich-jüdischen Dialogs müssten noch stärker in den Gemeinden verbreitet und auch in die Theologenausbildung einbezogen werden. Vor allem die jüngere Generation müsse für die Zusammenarbeit gewonnen werden.
Seit 2006 treffen sich Vertreter aus Kirchen und Judentum jährlich, um die aktuellen Beziehungen zwischen den Religionen und künftige Entwicklungen zu besprechen. (mit epd)