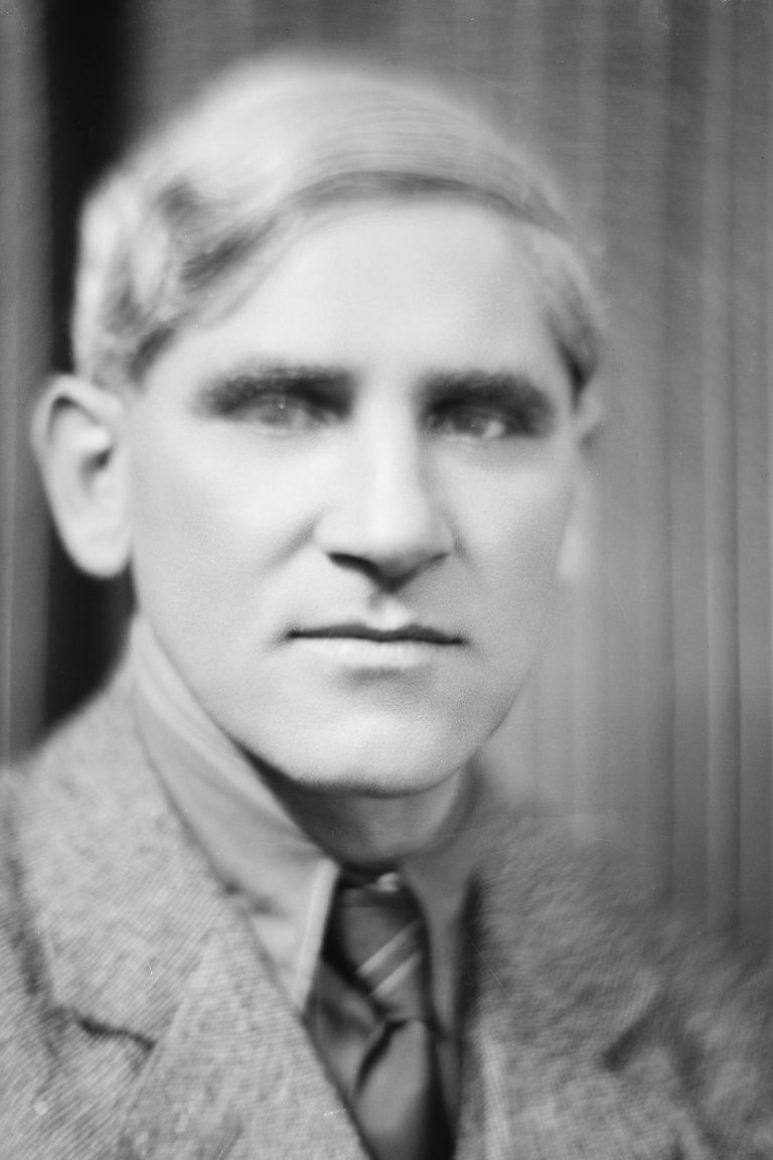»Frauen von Köln! Das Wahlrecht ist euch verliehen!« – Mit diesem Aufruf warb in großen Lettern die Deutsche Demokratische Partei auf einem ihrer Wahlplakate im Jahr 1919 um die Gunst der Wählerinnen. Dass Frauen seit der Weimarer Republik das Wahlrecht haben, ist entscheidend dem entschlossenen Einsatz einer engagierten Frau zu verdanken: Else Falk (1872–1956).
Vor allem in ihrer Kölner Zeit initiierte die in Barmen gebürtige Jüdin zahlreiche Altersheime für Frauen und förderte national und international soziale Projekte. Von 1919 bis 1933 war die in Brasilien gestorbene Sozialpolitikerin und Frauenrechtlerin die Vorsitzende des Stadtverbands Kölner Frauenvereine. Seit 2019 verleiht die Stadt Köln den nach Else Frank benannten Preis für Frauen- und Gleichstellungsarbeit. Eine Straße im Stadtteil Longerich erinnert an die engagierte Jüdin.
Auch in Köln-Riehl erinnert eine Straße an eine bedeutende Jüdin: Hertha Kraus (1897–1968). Die in Prag geborene spätere US-Bürgerin wurde 1923 von dem damaligen Oberbürgermeister Konrad Adenauer als Stadtdirektorin und Leiterin des Wohlfahrtsamtes an den Rhein geholt. Ab 1927 betrieb die engagierte Sozialdemokratin den Aufbau eines Sozialkomplexes mit Wohnstift, Pflegeheimen und Versorgungsbereichen für Personen mit physischen und psychischen Einschränkungen. Daraus gingen die bis heute bestehenden Riehler Heimstätten hervor.
Noch kurz vor dem Ende des Nationalsozialismus schrieb Adenauer an die in die USA emigrierte Jüdin und wollte sie mit den Worten zurückholen: »Ich kenne Ihre Hilfsbereitschaft und Ihre Arbeitsfreudigkeit. (…) Sie könnten sowohl der Stadt Köln wie Deutschland und unseren gemeinsamen Idealen sehr wertvolle Dienste leisten.« Kraus, an die die Technische Hochschule Köln mit dem nach ihr benannten Preis für besondere Abschlussarbeiten im Bereich Management der Sozialarbeit erinnert, kam zwar nicht mehr in die Stadtverwaltung zurück. Gleichwohl brachte sich die Sozialwissenschaftlerin bis zu ihrem Tod immer wieder entscheidend in den Aufbau der deutschen Sozialarbeit nach Weltkrieg und Holocaust ein.
Szenenwechsel Köln im 13. Jahrhundert. Die Stadt ist eine der großen jüdischen Gemeinden im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und spielt neben Mainz und Worms eine herausragende Rolle als eines der Zentren des geistigen und wissenschaftlichen Judentums. Der um 1250 im Rheinland geborene Ascher ben Jechiel (1250–1327) war einige Jahre in Köln tätig. Der Gelehrte verfasste eine Reihe von religiösen Texten, deren bedeutendster bis heute im Anhang des Talmuds abgedruckt wird. Auch ben Jechiels in Köln geborene Söhne Jakob und Jehuda spielen mit ihrem spirituellen und wissenschaftlichen Wirken bis heute eine bedeutende Rolle bei der Auslegung von Gesetzestexten.
Köln im 13. Jahrhundert ist eine der großen jüdischen Gemeinden im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und spielt neben Mainz und Worms eine herausragende Rolle als eines der Zentren des geistigen und wissenschaftlichen Judentums.
Falk, Kraus, ben Jechiel sind nur einige namhafte Beispiele für Juden aus Köln, die sich nachhaltig innerhalb der jüdischen Gemeinde, aber auch in Politik und Gesellschaft eingebracht und sie mitgestaltet haben. Das zeigt beispielsweise auch ein Blick ins 19. Jahrhundert. Als Köln 1798 nach dem Einmarsch napoleonischer Truppen französisch wurde und Juden nach 400 Jahren wieder in die Stadt zurückkehren konnten, kam auch der in Bonn geborene salomon oppenheim (1772–1828) an den damals aufstrebenden Bankenplatz.
Er etablierte eine Privatbank, die bis zum Jahr 2009 im Herzen von Köln ihren Sitz hatte und erheblichen Anteil am wirtschaftlichen Aufblühen und der in vielen Bereichen bis in die Gegenwart reichenden nachhaltigen ökonomischen Bedeutung der Rheinmetropole hatte. Jahrzehntelang brachten sich die später zum evangelischen Glauben konvertierten und vom preußischen König in den Freiherrenstand erhobenen Oppenheims in das politische und gesellschaftliche Leben ein.
Windsor Ein anderer bedeutender Kölner Bankier aus jüdischem Hause war Sir Ernest Cassel (1852–1921). Als Ernst Cassel in Köln geboren, gelangte er später als bedeutender Bankier und enger Vertrauter des britischen Königs Edward VII. zu Ruhm und Ansehen. »Windsor-Cassel«, wie er wegen seiner engen Beziehungen zum Königshaus auch genannt wurde, konvertierte seiner früh verstorbenen ersten Frau zuliebe zum Katholizismus, fühlte sich aber bis zu seinem Tod stets als Jude. 1913 war er einer der Mitbegründer der GAG Immobilien Köln, heute für rund 100.000 Menschen die größte Vermieterin in Deutschlands viertgrößter Stadt. Die nach dem vielfach sozial engagierten »kölschen Jung« aus der Altstadt benannte Ernst-Cassel-Stiftung unterstützt seit ihrer Gründung im Jahr 1932 die Mieter der GAG, die in soziale Notlagen geraten sind.
Zwar kein Kölner, aber von hier aus weit über Köln hinaus entscheidende Impulse gesetzt hat der herausragende jüdische Kaufmann Leonhard Tietz (1849–1914). Der aus der Nähe von Posen stammende Kaufmann eröffnete 1891 in der Hohe Straße auf 180 Quadratmetern ein Warenhaus. Angefangen hatte er in Stralsund mit einem Textilgeschäft auf 25 Quadratmetern. Es folgten ähnliche Geschäfte, unter anderem in der damaligen Metropole der Industrialisierung, Elberfeld. Dorthin legte Tietz auch seinen Unternehmenssitz für seine Mehrsparten-Warenhäuser nach französischem Vorbild.
Acht Jahre später und nach Eröffnung weiterer Häuser in Aachen und Düsseldorf verlegte Tietz den Unternehmenssitz von der Wupper an den Rhein. Hier verstarb er kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Aus den Warenhäusern der Leonhard Tietz AG wurden in der Zeit des Nationalsozialismus, als die Nachkommen von Tietz verfolgt wurden, die Westdeutsche Kaufhof AG und später dann die Galeria Kaufhof GmbH.
Opfer der Nazis wurde der Pädagoge Erich Klibansky (1900–1942). An die etwa 1100 aus Köln stammenden und ermordeten jüdischen Kinder sowie an den langjährigen Leiter der »Jahwne«, des ersten jüdischen Gymnasiums im Rheinland, erinnert der Erich-Klibansky-Platz in der Kölner Innstadt. Er befindet sich genau dort, wo von 1919 bis 1942 das »Private jüdische Reform-Realgymnasium mit Realschule für Knaben und Mädchen« bestand.
Rund 130 Schülerinnen und Schülern konnte Klibansky noch zur Emigration nach Großbritannien verhelfen. Er selbst wurde 1942 nahe Minsk umgebracht. Heute gibt es an dem nach ihm benannten Platz den »Lern- und Gedenkort Jahwne«.
Musik Der bekannteste nach einem Juden benannte Platz ist sicherlich der Offenbach-Platz. Der in Paris von seinem Kollegen Gioachino Rossini als »Mozart der Champs-Elysées« geadelte und später zum Katholizismus konvertierte Komponist Jacques Offenbach (1819–1880) blieb seiner Heimat stets verbunden. Schon als Kind hatte der im Haus Großer Griechenmarkt 1 geborene, liebevoll auf kölsch »Köbes« gerufene Musiker seinen Vater Isaac (1780–1850) bei Auftritten in Lokalen und Vergnügungsstätten begleitet. Der reisende Musiker Isaac war 1816 in Köln sesshaft geworden. Als Kantor der jüdischen Gemeinde in der Glockengasse wirkte er selbst als Komponist und Dichter. Sein Grab befindet sich auf dem jüdischen Friedhof im Stadtteil Deutz.
Ein weiterer jüdischer Künstler, der mit Köln eng verbunden war, ist Otto Freundlich (1878–1943). Der in Pommern geborene Maler und Bildhauer, in einem Konzentrationslager ermordet, gilt als einer der ersten Vertreter der abstrakten Kunst. 1919 organisierte er unter anderem mit dem aus Brühl stammenden, später weltberühmten Bildhauer und Maler Max Ernst die international beachtete erste Kölner Dada-Ausstellung. Die Nationalsozialisten entfernten die Werke von Freundlich als »entartet«.
International von Bedeutung war zudem das von Köln ausgehende politische Engagement von Juden für den Zionismus.
International von Bedeutung war zudem das von Köln ausgehende politische Engagement von Juden für den Zionismus. Der in Köln tätige Rechtsanwalt Max Isidor Bodenheimer (1865–1940) war lange Zeit einer der einflussreichsten Funktionäre der Bewegung, die sich seit Ende des 19. Jahrhunderts für einen selbstständigen Nationalstaat der Juden in Palästina einsetzte.
Spinoza Dabei kam einer der geistigen Väter und Vorläufer der Bewegung ebenfalls aus Köln: Moses Hess (1812–1875). Der in Bonn geborene Philosoph und Schriftsteller übte in seiner Kölner Zeit, nicht zuletzt aufgrund einer von ihm gegründeten sozialistischen Tageszeitung, erheblichen Einfluss auf Karl Marx und Friedrich Engels aus. Bereits im Jahr 1837 hatte er sich in Anlehnung an den frühneuzeitlichen jüdischen Philosophen Baruch de Spinoza in seinem Werk Heilige Geschichte der Menschheit. Von einem Jünger Spinozas dezidiert für die Aufhebung der Klassenunterschiede, Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Gesundheitssorge und Wohlfahrt als staatliche Aufgaben ausgesprochen.
Zudem artikulierte er immer deutlicher ein jüdisches Nationalbewusstsein und postulierte in seinem Werk Rom und Jerusalem aus dem Jahr 1862 einen Anfang zur Wiederherstellung des jüdischen Staates; dieser Anfang wird zunächst wohl in der Gründung jüdischer Kolonien im Lande der Väter bestehen. Bemerkenswert ist eine Einschätzung von Theodor Herzl über den in Deutz beigesetzten zionistischen Vordenker aus dem Rheinland. Denn Herzl, der gemeinhin als eigentlicher Urheber des Zionismus bekannte Schriftsteller, urteilte nach der Lektüre von Rom und Jerusalem, dass »seit Spinoza das Judentum keinen größeren Geist hervorgebracht hat als diesen vergessenen verblassten Moses Hess«.
Herzl räumte sogar ein, dass er sein eigenes, später so wegweisendes Werk Der Judenstaat wohl nicht verfasst hätte, wenn er zuvor Rom und Jerusalem gelesen hätte. Hess wurde – wie Hertha Kraus und andere Kölner Juden – mit einer Figur am Turm des historischen Rathauses geehrt. Eine Straße im Stadtteil Stammheim ist nach ihm benannt. Zudem ist eine Siedlung in der Scharonebene nahe Tel Aviv – Partnerstadt von Köln – nach dem Rheinländer mit »Kfar Hess« benannt.
Märzrevolution Während Hess in Köln für seine frühsozialistischen Ideen und Ideale eintrat und damit über die Rheinmetropole hinaus für Aufsehen und Debatten sorgte, erfreute sich zu dieser Zeit gleichzeitig ein anderer Jude höchster Anerkennung. Der in Düsseldorf geborene Arzt und später in der Arbeiterbewegung sowie während der Märzrevolution 1848 aktive Andreas Gottschalk (1815–1849), Absolvent des nach wie vor bestehenden Kölner Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums. Seit Eröffnung einer eigenen Praxis 1842 behandelte er oftmals kostenlos mittellose Patienten. Um diese kümmerte sich der 1844 zum Protestantismus konvertierte und im Stadtteil Bocklemünd mit einer Straße geehrte Arzt insbesondere im Jahr 1849.
Damals wurde Köln von einer verheerenden Cholera-Epidemie heimgesucht. Unter den rund 10.000 Toten, die der Seuche zum Opfer fielen, war auch Andreas Gottschalk. Tausende Kölner nahmen an dessen Beerdigung auf dem zentralen Friedhof Melaten teil. Auf seinem Grabstein steht: »Eins ist nötig, dass das Gute stets geschehe, ob man falle oder stehe, ist und bleibt dann einerlei.«