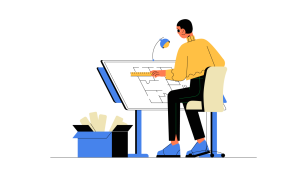Eines der Hauptanliegen der Tora ist es, die Familie zu stärken und zu stützen. Das geschieht auf vielfältige Art und Weise. Einer der Gründe für diese Haltung ist, dass nur die intakte, harmonische Familie dem Einzelnen beisteht, ihn in der Not behütet und ihm Geborgenheit vermittelt. Dadurch kann auch der Gemeinschaft der Weg zur Gesundung und zum sozialen Ausgleich gewiesen werden, um Konflikte abzubauen.
Der Tora geht es nicht darum, strenge Gesetze aufzustellen, wie häufig behauptet wird. Vielmehr will sie uns durch ihre narrative Methode ermuntern und zum Handeln anregen. Allerdings erzählt sie uns niemals Geschichten und Legenden von makellosen Heiligen. Im Gegenteil: Sie berichtet von Menschen: Männern, Frauen und Kindern, die oft sogar sehr schwere Fehler begehen. Viel seltener gelingt es ihnen, auf ihrem Lebensweg das Richtige zu tun. Gerade das ist für uns Juden, die die Tora als Erste ansprechen will, hilfreich und nützlich. Wir sollen daraus Lehren ziehen für unser Leben.
Die Parascha für diesen Schabbat enthält eine besondere Episode. Vielleicht ist sie sogar ein Hauptthema, das sich nur als Episode tarnt (1. Buch Moses 38). Am Anfang des Kapitels erfahren wir, dass Jehuda, der Sohn Jakows, des letzten Erzvaters, geheiratet hat. Die Tora berichtet nicht von den Eheschließungen der anderen Söhne, nur von Jehudas und später Josefs Hochzeit. Jehuda war zwar nicht der älteste Sohn, stieg später aber dennoch zur Führungsfigur auf. Unser Volk ist in den meisten Sprachen der Welt nach ihm benannt. »Heilsgeschichtlich« jedoch heißen wir »Israeliten«, nach dem später erworbenen Namen des Erzvaters Jakow.
Tragik Jehuda und seiner Frau wurden drei Söhne geboren. Als sie erwachsen waren, heiratete der älteste Sohn – er hieß Er – die schöne Tamar. Die Ehe endete tragisch: Der Ehemann starb bald nach der Hochzeit. Die Exegeten vermuten hinter dem frühen Tod einen g’ttlichen Eingriff. Über ihn lesen wir in der Tora: »Er war böse vor dem Herrn« (1. Buch Moses 38,7), ohne Details zu erfahren. Der Midrasch schließt häufig die Lücken in den Darstellungen der Tora. So auch hier: Der Ehemann Tamars wollte keine Kinder. Der Gelehrte Josef ben Isaak, der Bechor Schor, der im zwölften Jahrhundert in Frankreich lebte, meinte, dass Tamars Ehemann nicht die Mühe der Kindererziehung auf sich nehmen wollte. Er eignete sich also weder als Ehemann noch als Familienvater.
In biblischen Zeiten war es üblich, dass der Schwager die Witwe ehelichte. Der Grund für diese sogenannte Leviratsehe war, dass die Familie die Versorgung der meist mittellosen Witwen auf sich nehmen sollte. Ein Sozialamt mit seinem engmaschigen Netz der Fürsorge kannte das Altertum nicht. Sich in ihrer Not anderswo einen Arbeitsplatz zu suchen, wollte man der Witwe nicht zumuten.
Jehudas zweiter Sohn, der nun an der Reihe gewesen wäre, Tamar zu heiraten, dachte nicht daran, diese familienpolitischen Grundsätze zu beherzigen. Er wollte nicht, dass die Witwe ihren Platz in der Familie behält. Nach einer Weile starb auch er. Seinen dritten Sohn wollte Jehuda nicht mehr als Ehemann für Tamar hergeben, vielleicht aus Angst, dass auch dieser sterben würde. Stattdessen schickte er die Frau ins elterliche Haus zurück. Dies galt damals als Unrecht.
Prostituierte Tamar beschloss, um Gerechtigkeit zu kämpfen. Sie tat es auf ihre Art und heckte einen findigen Plan aus. Sie stellte sich mit verhülltem Gesicht an eine Straßenkreuzung, als wäre sie eine Prostituierte. Sie wusste, dass ihr Schwiegervater Jehuda genau diesen Weg nahm, um nach Hause zu gelangen. Die von ihr gestellte Falle schnappte zu. Jehuda, dessen Ehefrau zu dieser Zeit nicht mehr lebte, schlief mit der Prostituierten. Als Lohn für ihre Dienste vereinbarten sie ein Ziegenböcklein. Doch bis zur Bezahlung ließ Jehuda seinen Stock und Stempel, einige seiner persönlichen Gegenstände, als Pfand zurück.
Als Jehuda am nächsten Tag seinen Boten mit dem Ziegenbock, den er der Prostituierten als Lohn versprochen hatte, an die Wegkreuzung schickte, war die Frau dort nicht mehr anzutreffen.
Drei Monate waren vergangen, da erzählte man Jehuda, dass seine Schwiegertochter, die Witwe seines Sohnes, schwanger wäre. Dies war für den Patriarchen und Stammesfürsten eine Schande und ein Verbrechen zugleich. Als man jedoch die Frau vor die Sippe rief, um über sie den Stab zu brechen, legte Tamar die Pfandstücke vor und fragte öffentlich, wem diese Gegenstände wohl gehören. »Von diesem Mann erwarte ich das Kind.«
Alle erkannten die Pfandstücke und wussten, dass Jehuda es war. Der Patriarch, der selbst hatte Recht sprechen wollen, war bloßgestellt. Nun musste er öffentlich zugeben: »Sie ist gerechter als ich« (38,26) – eine Lehre für alle Patriarchen.
Maschiach Tamar war es nicht nur auf ihre Weise gelungen, ihr Recht einzuklagen und durchzusetzen. Die Rabbinen fügen hinzu: Von den Zwillingen, die Tamar gebar, stammte später sogar der König David ab, aus dessen Nachfahren eines Tages der Maschiach, unser Erlöser, kommen wird. Die Rabbinen gehen noch weiter und meinen, dass Tamar in Folge ihrer Handlungsweise auch dadurch belohnt wurde, dass durch sie die messianische Idee entstand. Es entspricht der jüdischen Geschichtsbetrachtung, dass G’tt in der Historie aktiv wirkt und jedes Ereignis auch einen endzeitlichen, eschatologischen Sinn hat.
Der Autor war von 1981 bis 2002 Landesrabbiner von Württemberg.
Inhalt
Der Wochenabschnitt Wajeschew erzählt, wie Josef – zum Ärger seiner Brüder – von seinem Vater Jakow bevorzugt wird. Zudem hat Josef Träume, in denen sich die Brüder vor ihm verneigen. Eines Tages schickt Jakow Josef zu den Brüdern auf die Weide. Die Brüder verkaufen ihn in die Sklaverei nach Ägypten und machen Jakow glauben, ein wildes Tier habe Josef gerissen. Doch in der Sklaverei steigt Josef zum Hausverwalter auf. Nachdem ihn die Frau seines Herren Potifar der Vergewaltigung beschuldigt hat, wird Josef ins Gefängnis gesperrt. Dort deutet er die Träume des königlichen Obermundschenks und des Oberbackmeisters.
1. Buch Moses 37,1 – 40,23