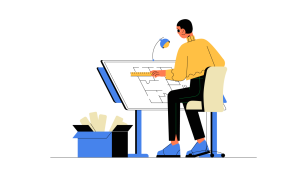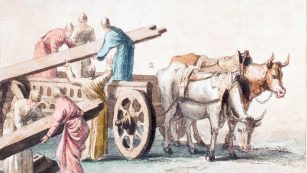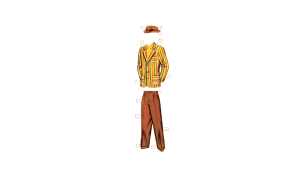Rabban Schimon Ben Gamliel lehrte: »Mein ganzes Leben bin ich unter Weisen herangewachsen und fand nie Besseres für den Körper als Schweigen. Auch ist das Forschen nicht die Hauptsache, sondern die Tat ist es. Und zu viel zu sprechen, führt Sünde herbei« (Sprüche der Väter 1,17).
Interpreten dieser Mischna hat die Frage beschäftigt, welche Art Schweigen der Tannait gelobt hat. Ein absolutes Schweigen war sicher nicht gemeint, denn sowohl über Tora-Gedanken als auch über praktische Angelegenheiten sollte man durchaus reden.
BELEIDIGUNGEN Rabbiner Seckel Bamberger (1863–1944) nennt drei Fälle, in denen Schweigen lobenswert ist: »In Bezug auf Unterhaltung über gleichgültige Dinge, aber auch in Bezug auf die Hinnahme von Beleidigungen, ohne wieder zu beleidigen, wodurch dem Menschen viel Kummer und Verdruss erspart bleibt. Gleichzeitig enthält Schimons Ausspruch auch die Lehre, dass der Schüler beim Unterricht des Lehrers aufmerksam zuhören und wenig sprechen soll, wenn dies nicht zur Stellung einer Frage erforderlich ist.«
Ganz anders interpretiert es Rabbenu Bachja Ben Ascher (1255–1340). Der spanische Kommentator meint, der Tannait habe ein Schweigen gelobt, das für den Körper (hebr. Guf) gut sei.
In der Tat steht in der Mischna das Wort »Guf«. Dieser Begriff ist allerdings von einigen Autoren frei übersetzt worden. So lesen wir bei Rabbiner Bamberger: »Ich fand nie Besseres für den Menschen«, und Rabbiner Jonathan Sacks (1948–2020) schreibt: »Nothing is better for a person.« Der Grund für die Umdeutung ist leicht zu erraten: Die genannten Übersetzer fanden die Aussage, Schweigen sei gut für den Körper, problematisch.
Die Übersetzung von Rabbiner Samson Raphael Hirsch (1808–1888) lautet: »Ich habe für das sinnlich Leibliche nichts Besseres als Schweigen gefunden.« In seinem Kommentar referiert er die Auffassung von Rabbiner Jesaja Horowitz (1565–1630), des Autors von Schne Luchot HaBerit: »Für die körperlich sinnliche Seite des Menschen und deren Angelegenheiten ist das Schweigen das Beste. Ihnen muss pflichtgemäß fürgesorgt, aber nicht viel von ihnen gesprochen werden. (…) Es gibt in der Tat nichts Widerwärtigeres als das große und wichtigtuende Behagen, mit welchem Menschen sich über Gut-Essen und Trinken unterhalten.« Diese Bemerkung ist sicher beachtenswert – aber trifft die Kritik die Intention der Mischna?
Laschon Hara Kehren wir nun zurück zur Interpretation von Rabbenu Bachja. Welches Schweigen ist nach seiner Meinung gut für den Guf? Der Tannait spricht von dem Fall, wenn jemand schweigt, statt etwas Nachteiliges über einen anderen Menschen zu erzählen (Laschon Hara).
Denn nach Ansicht unserer Weisen ist es der Körper, der für diese Sünde bestraft wird. Rabbenu Bachja zitiert folgenden Midrasch: »Aussatzplagen kommen wegen Laschon Hara, denn es heißt: ›Gestatte deinem Mund nicht, deinen Leib in Schuld zu bringen‹ (Kohelet 5,5) – sprich nicht etwas, das deinem Körper eine Strafe bringt.«
Nach Bachjas Deutung erwähnte Schimon Ben Gamliel sein Heranwachsen unter Weisen, um einen Kontrast zu schaffen: Ich sah, welche Reden nützlich und erlaubt sind – aber wenn es um Laschon Hara geht, dann ist Schweigen Gold!
forschen Der zweite Satz von Schimon Ben Gamliel lautet: »Auch ist das Forschen nicht die Hauptsache, sondern die Tat.« Warum folgt diese These auf das Lob des Schweigens? Gibt es zwischen dem ersten und dem zweiten Satz einen Zusammenhang? Rabbiner Owadia Bartenura (1445–1515) erklärt: So wichtig gelehrte Erörterungen im Lehrhaus sind, so wäre Schweigen doch besser für denjenigen, der nur redet und nicht praktiziert!
Auch der Zusammenhang zwischen dem zweiten Satz unserer Mischna und der Feststellung »Zu viel zu sprechen führt Sünde herbei« bedarf einer Erklärung. Im Kommentar von Rabbiner Hirsch heißt es: »Einen ganz besonderen Nachteil hat aber vieles Reden, dass die Menschen, nachdem sie lange und viel und eifrig von etwas und für etwas gesprochen, sich nun bereden, sie hätten etwas getan, und wenn ihr Inneres sie der Vernachlässigung der Sache anklagen möchte, sie sich dann damit beschwichtigen, sie hätten doch so eifrig warm und glänzend davon und dafür gesprochen!«