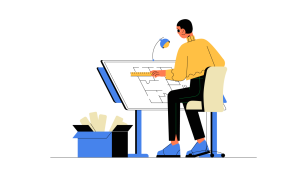Die Texttradition des Judentums ist reich. Etwa 120 Generationen trennen uns von König David; etwa 80 Generationen von den Rabbinen, die die rabbinische Auslegungstradition begründeten und das Studium der Heiligen Schrift zu ihrer wichtigsten Aufgabe machten.
In der Tat sind 80 Generationen eine lange Zeit, um an einem Text und seiner Deutung zu arbeiten. Das jüdische Wort für diese grundlegende Beschäftigung mit Gottes Wort ist »Tora« – Judentum ist ein nichtjüdisches Wort, eine Fremdbezeichnung.
SCHATZ Nicht alle Juden waren aktiv und kreativ am Torastudium beteiligt. Auch wenn nur wenige Gelehrte in jeder Generation ihre gesamtintellektuelle Anstrengung, ihre Vorstellungskraft und Inspiration in das Studium der Tora einfließen ließen, so wurde uns doch ein mehrere Hundert Generationen umfassender Schatz von großer Tiefe und enormem Reichtum geschenkt.
Aufgrund der prinzipiellen rabbinischen Wertschätzung unterschiedlicher Meinungen und Deutungen und aufgrund des Verständnisses für die potenzielle zukünftige Relevanz von abgelehnten Ansichten und Minderheitenpositionen zu jedem nur denkbaren Thema beinhaltet und bewahrt dieser Schatz eben auch unterschiedliche und divergierende Meinungen.
Es ist wie ein Dachboden mit den etwas chaotisch verstreuten und gelagerten Schätzen eines Volkes, das, um es mit den Worten des Religionsphilosophen und Rabbiners Abraham Joshua Heschel (1907–1972) zu sagen, Kathedralen eher in der Zeit als am Ort baute.
In jeder Generation und innerhalb der Gemeinschaften des Judentums wird dieses Erbe gepflegt und zu einer »nutzbaren« und aktualisierbaren Vergangenheit gemacht, die einer bestimmten Vorstellung von den Bedürfnissen und Werten der Gegenwart (und speziell innerhalb einer bestimmten Gemeinschaft) entspricht.
Dekonstruktion Meines Erachtens besteht der primäre Beitrag der Judaisten als Wissenschaftler in der Dekonstruktion dieser Erinnerungs- und Ideologiekomplexe und in der Offenlegung der gesamten Tiefe und Breite der Tradition unter Einschluss des Vergessenen und Verdrängten.
Was mich persönlich an der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, an der Judaistik als Disziplin reizt, ist ihr impliziter Protest. »Geheime Geschichten«, also die gerade angesprochene vergessene und verdrängte Überlieferung, sind immer auch ein Aufbegehren gegen die Tyrannei der Gegenwart und auch die Tyrannei des Erwarteten und Erwartbaren, eine Alternative zur Bestätigung und Verfestigung des bereits Bekannten.
Ich lehre dementsprechend nicht, »was das Judentum ist«, sondern befasse mich als Wissenschaftler mit der Vielfalt des Judentums im Laufe der Jahrhunderte; all das, was es (vor allem seit dem Mittelalter) für Juden war und bedeutete. Aber ich interessiere mich genauso dafür, wie sich die Moderne auf das jüdische religiöse Denken und Leben ausgewirkt hat.
GEBOTE Wenn wir uns einen traditionellen jüdischen Gelehrten vorstellen, sehen wir, dass er eine Vielzahl von Geboten in allen Lebensbereichen befolgt. Zwei, die besonders betont werden, sind das Gebet und das Studium der Tora. Mein Freund, der Rabbiner Amichai Lau-Lavie, fasst das jüdische Gebet wie folgt zusammen: »Danke, wow, oops, bitte« – also als ein Danken, Erstaunen, als ein die eigene Unzulänglichkeit Erkennen und Bitten. Das Toralernen betrachteten die Rabbiner der Spätantike als Grundlage des jüdischen Lebens und als größtes aller Gebote, weil es zu allen anderen führt.
Meine religiöse Praxis hat mein kritisches Studium beflügelt.
Im akademischen Kontext ist das Torastudium – selbst im weitesten Sinne – weder mit der Praxis noch mit den Geboten verbunden. Gibt es jedoch einen Konflikt zwischen der Ausübung des traditionellen religiösen Torastudiums und der kritischen wissenschaftlichen Forschung?
Ich habe den Eindruck, dass ein solcher Konflikt lange Zeit aufgrund der Unsicherheiten einer noch jungen wissenschaftlichen Disziplin angenommen oder unterstellt wurde. Können Philosophen denn nie als Philosophiehistoriker arbeiten? Können Musiker und Komponisten nicht über Musikwissenschaft publizieren? Wird denn von den Vertretern vieler Traditionen nicht erwartet, dass sie mit den großen Debatten und auch mit abweichenden Positionen, zeitgenössischen wie historischen, vertraut sind?
WISSENSCHAFT In der Tat muss es keinen Widerspruch zwischen kritischem Wissen und engagierter Praxis geben. Andererseits dürfen wir von Wissenschaftlern aber nicht notwendig erwarten, dass sie Praktiker sind, und sie nicht abwerten, wenn sie sich gerade nicht persönlich mit dem Gegenstand ihrer Forschung identifizieren – von Meeresbiologen verlangen wir ja auch nicht, dass sie Fische sind.
Der analytische Modus beinhaltet eine reflexive, kontextualisierende Orientierung, die historische Werkzeuge und Methoden einsetzt, allen voran die Philologie für das Textstudium. Der Modus des Praktikers ist performativ und direkt. Die beiden Modi bereichern einander, sind aber unterschiedlich.
In meinem Leben haben sich diese beiden Aspekte stets bereichert. Meine religiöse Praxis hat mein kritisches Studium beflügelt und umgekehrt. Dank der kritischen Geschichtswissenschaft entdeckte ich Ausdrucksformen des Judentums in der vormodernen Welt, die ich durch meine Vertrautheit mit der zeitgenössischen Szene nie erfahren hätte. Ich fand ein Judentum, das sich durch Offenheit, durch wilde, ungezähmte Aussichten auszeichnet.
Chaos Ich fand ein beständiges heiliges Chaos, eine dezentralisierte Autorität, einen wertschätzenden und respektvollen Umgang mit abweichenden Meinungen, vor allem aber eine prinzipielle Verpflichtung zur Barmherzigkeit. Ich fand Fluidität, intellektuelle Präzision und gut gelaunte Selbsterkenntnis. Ich fand eine Fülle von Ideen und eine Vielzahl von Meinungen: eine schillernde Polyphonie, teilweise eine Kakophonie mit gerade genug Ähnlichkeit, um inmitten von Unterschieden Identität und Gleichklang herzustellen.
Mein Eindruck war stets, dass die Moderne (in Form reaktionärer Ideologien) das Judentum von drei auf zwei Dimensionen abgeflacht hat. Nichts könnte weiter vom Wesen des vormodernen Judentums entfernt sein als »Orthodoxie«. Diese Einsicht hat mein Interesse am Übergang zur Moderne geweckt und dazu geführt, dass ich begann, mich als Kulturhistoriker mit der Frühen Neuzeit zu befassen. Trotz meiner Abneigung gegen die Orthodoxie wegen ihrer reaktionären Revision des Judentums habe ich den größten Teil meines Erwachsenenlebens damit verbracht, einen orthodoxen Lebensstil in orthodoxen Gemeinschaften zu führen. Und warum?
Es gibt viele Bewegungen, mit denen sich Juden identifizieren, darunter die religiösen Konfessionen »konservativ«, »masoretisch«, »reformiert«, »rekonstruktivistisch« und andere mehr. Soziologische Studien haben gezeigt, dass die jüdische Welt in orthodoxe und nicht-orthodoxe Gruppen unterteilt werden kann. Die Nicht-Orthodoxen leben wie jeder andere (und wie ihre Altersgenossen in der allgemeinen Bevölkerung). Die Orthodoxen tanzen nach einem anderen Rhythmus. Der attraktive Aspekt dieses alternativen Lebensstils war für mich das Eintauchen in die Tora: in das Studium der Tora und in ihre andächtige Ausübung. Das konnte ich nirgendwo anders finden. Leider machte das reaktionäre intellektuelle Klima eine vollständige Identifikation damit für mich unmöglich. Wie der Religionsphilosoph Akiva Ernst Simon (1900–1988) sagte: »Ich kann nicht mit den Leuten reden, mit denen ich bete, und ich kann nicht mit den Leuten beten, mit denen ich rede.«
Religion besteht vor allem aus Barmherzigkeit gegenüber Fremden, Armen und Schwachen.
Kann die jüdische Tradition eine Hilfe bei der Arbeit an der existenziellen Orientierung in der heutigen Welt sein? Für Juden? Für andere? Die jüdische Spiritualität gehört nicht zu den großen Gewinnern der Kommerzialisierung der Religion in unserer Zeit. Madonna und andere prominente Kabbala-Schüler könnten als Gegenargument gelten, obwohl die Kabbala, die sie studieren, vielleicht nicht so eng mit dem traditionellen, historischen Judentum verbunden ist. In der Vormoderne gab es keine Erwartung, eine spirituelle, existenzielle Botschaft in einer universellen Sprache zu formulieren. Die Frage »Wie soll es weitergehen?« wäre nur für ein internes Publikum beantwortet worden.
Ressourcen Selbst jemand wie Martin Buber (1878–1965), dessen Ich und Du (1923) heute allgemein bekannt ist, wandte sich im Vorkriegsdeutschland vor allem an die jüdische Gemeinschaft, indem er Ressourcen aus der jüdischen Tradition bereitstellte, von denen er annahm, dass sie modernen, nicht-religiösen Juden bei ihrer existenziellen Orientierung helfen könnten.
Erschwerend kommt hinzu, dass der Chassidismus vor dem Holocaust die größte jüdische Einzelgruppe war – und er war in einer Weise mystisch und spirituell orientiert, die in der jüdischen Welt ihresgleichen suchte. Mit der Ermordung von Millionen chassidischer Juden und ihrer Rabbiner, ihrer spirituellen Meister – wer blieb da noch übrig, um diese Haltung zu lehren? Und konnte man von den Überlebenden wirklich erwarten, dass sie nach einem Völkermord inspirierende Lehrer der Spiritualität seien?
Wertschätzung von Komplexität, Meinungsverschiedenheiten und nuancierten Argumenten: Im Prinzip sollte all dies gegen Demagogie immunisieren. Bedauerlicherweise haben reaktionäre jüdische Gruppen dennoch das scheinbar Unmögliche geschafft und sich mit aller Kraft gegen diese grundsätzlichen Qualitäten der Tradition gewehrt.
ABTREIBUNG Ein aktuelles Beispiel. Gerade in den vergangenen Monaten konnten wir beobachten, wie die Abtreibung im amerikanischen Kontext behandelt wurde. Das »Right to Life«-Lager, das darauf besteht, dass Abtreibung Mord sei, sich aber gleichzeitig kaum um den Verkauf von Sturmwaffen ohne Hintergrundüberprüfung kümmert und nicht bereit ist, alleinerziehenden Müttern Sozialleistungen zu gewähren, ist in seinem Ansatz ganz simpel.
Es gibt für diese Menschen keine Gründe für eine Abtreibung, auch nicht nach der Vergewaltigung einer Minderjährigen. Ein Blick auf die rabbinischen Diskussionen über Abtreibung, die ethische und sogar biblische Erwägungen berücksichtigen, aber ohne die unreflektierten Axiome, die der aktuellen Debatte zugrunde liegen, wäre heilsam.
Ich habe kein einfaches Rezept, wie wir weitermachen können. Als Historiker weiß ich, dass das Judentum über Ressourcen verfügt, die gerade jetzt und heute wertvoll sein könnten, wenn Juden und andere Herz und Verstand öffnen würden, um zuzuhören.
Mitgefühl Wie wertvoll wäre es, wenn die Menschen entdecken würden, dass Religion die Welt nicht polarisieren muss, gesunde Meinungsverschiedenheiten zulassen kann, dass sie in erster Linie in Mitgefühl bestehen sollte? Und zwar nicht in theoretischer Barmherzigkeit, die die Seele im Jenseits erwartet, sondern in einer Barmherzigkeit der Gesetzgebung und der Rechtssysteme im Hier und Jetzt, einer Barmherzigkeit gegenüber Fremden, Schwachen und Armen.
Wie wertvoll wäre es, wenn nicht der heilige Krieg, sondern der heilige Frieden als höchster religiöser Wert gefördert würde? Wenn Friedensverträge als Erfüllung von Gottes Vision für die Welt unterzeichnet würden, wie sie von den religiösen Führern der im Krieg befindlichen Nationen verstanden wird? Wie wertvoll wäre es, wenn der Wert der Nachhaltigkeit – der Kern der biblischen Forderung nach einem Schabbatjahr – auch als ein religiöser Wert gefördert und gefordert würde?
Der Autor ist Sir Isaac Wolfson Professor of Jewish Thought am Department of Jewish History an der Universität Haifa.