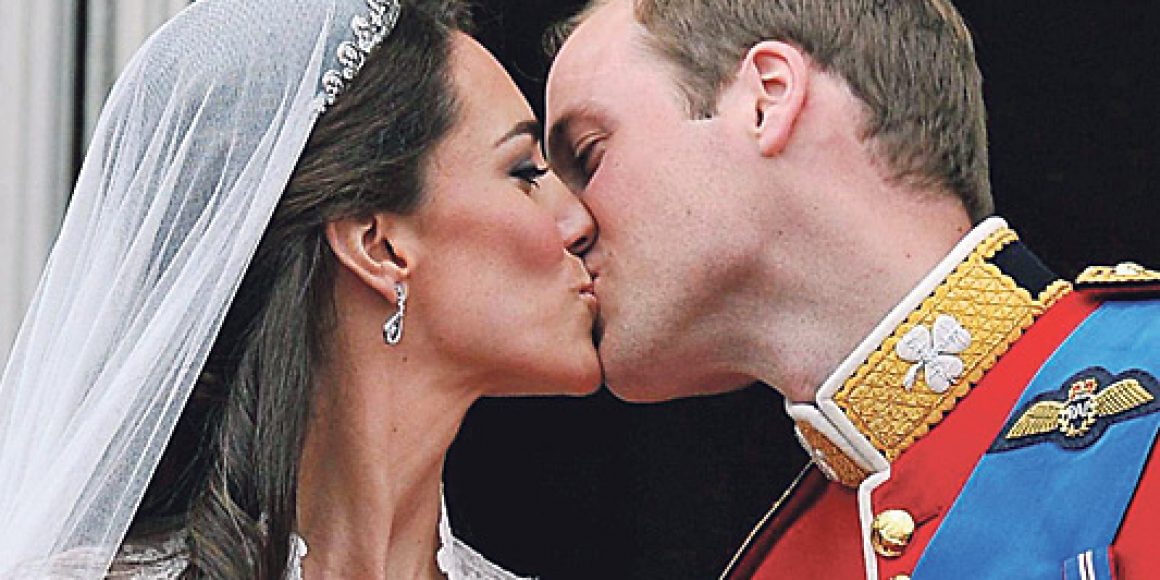Der Wochenabschnitt Emor, fast in der Mitte der Tora, ist Teil des Heiligkeitsgesetzes (Torat Kohanim). Es legt fest, wie der Opferkult im Heiligtum vor sich gehen soll. Dazu gibt es präzise Bestimmungen über das Heiligtum selbst, die Opfer und die Priester (Kohanim), die die Opfer darbrachten. Das Heiligtum in der Wüste ist heute genauso Vergangenheit wie der Erste und der Zweite Tempel in Jerusalem. Aber Kohanim gibt es auch heute noch. Es lohnt sich, diesen merkwürdigen Umstand einmal genauer zu betrachten.
Die Tora, ja der ganze Tanach sieht die Dinge weitgehend aus der Perspektive der Priester. Sie liefern den Maßstab, nach dem alles andere beurteilt wird. Wenn man sich aber die biblischen Berichte selbst anschaut, so haben nicht die Priester das Sagen, sondern Mosche, Jehoschua, die Richter und die Könige.
Der Tempelbau in Jerusalem nimmt im Tanach einen viel größeren Raum ein als der Bau des Palastes. Schaut man auf die berichteten Maße, wird aber sofort deutlich, dass der Tempel eher eine Palastkapelle war, fast ein Anhängsel der scheinbaren Hauptsache, des königlichen Palastes.
Status Wirkliche politische Macht haben die Priester erst nach dem Exil ausgeübt. Und zur Zeit des Zweiten Tempels war der Hohepriester zugleich auch politischer Führer des Volkes. Mit der Zerstörung des Tempels durch die Römer im Jahr 70 verloren die Priester ihre Macht an die Rabbinen. Die bis heute bestehenden Vorrechte der Priester sind exakt die, die die Rabbinen ihnen aus Höflichkeit und politischer Taktik gelassen oder auch neu eingeräumt haben. Wenn wir nun den heutigen Status der Priester, der Kohanim, betrachten, so lässt sich dieser nur als Ergebnis dieser historischen Situation verstehen.
Was also ist der Status von Kohanim heute? Zuallererst muss man sagen, dass halachisch gesehen alle heutigen Kohanim nur vermutlich solche sind. Schon Maimonides in Issure Bia und auch der Magen Awraham zum Schulchan Aruch haben festgestellt, dass keinerlei Beweis für priesterliche Abstammung derjenigen vorliegt, die in der Gegenwart behaupten, Kohanim zu sein.
Aus der jüngeren Geschichte wissen wir auch, dass sehr viel mehr Kohanim in Amerika ankamen, als in Europa abgefahren waren. Aus für amerikanische Ohren komplizierten slawischen Namen wurde beim Einwandern auf Ellis Island schnell einmal ein einfacher Sam Cohen. Trotzdem gelten für die Männer, die sich in väterlicher Linie von einem Kohen ableiten, auch heute bestimmte Einschränkungen und Vorrechte.
Priestersegen Am sichtbarsten sind die Vorrechte. Kohanim werden in traditionellen Synagogen als Erste zur Tora aufgerufen. Und sie sind es auch, die den besonders feierlichen Priestersegen für die ver- sammelte Gemeinde sprechen. Meir von Rothenburg legte im Mittelalter sogar fest, dass in einer Gemeinde, die nur aus Kohanim bestünde, Frauen die zweite bis siebte Alija zur Tora erhalten sollen. Dies sei besser, als einen Kohen mit einer Alija zu beleidigen, die einem »gewöhnlichen Juden« zukommt.
Gleichzeitig sehen wir in der Art und Weise, wie der Priestersegen von den Kohanim gesprochen wird, eine vollständige Entmachtung. Außerhalb Israels sagen die Kohanim den Segen sowieso nur viermal im Jahr. Dabei müssen sie dem Vorbeter jedes Wort einzeln genau nachsprechen. So werden die Kohanim auf ein reines Rezitieren von Texten festgelegt und damit von den Rabbinern vollständig kontrolliert.
Grenzen In zwei Bereichen unterliegen die Kohanim Beschränkungen. Sie dürfen nicht mit Toten in Berührung kommen, und es gibt für sie Heiratsbeschränkungen. Sie dürfen keine Geschiedene, keine »Unzüchtige«, keine Übergetretene und auch keine Chalitza (eine Witwe, der die Schwagerehe verweigert wurde) heiraten. Zumindest die Heirat mit einer Übergetretenen ist aber post factum gültig. Der Kohen darf aber dann seine besonderen Rechte nicht ausüben und vererbt sie auch nicht an seine Kinder. Doch haben die Kinder genau den gleichen Status wie alle anderen Juden auch.
Am schwierigsten für uns heute ist die Bestimmung, dass die Kohanim nicht mit Toten in Berührung kommen dürfen – also auch nicht nach jüdischem Ritus trauern dürfen, außer bei den sechs engsten Verwandten. Unsere Parascha nennt Mutter, Vater, Sohn, Tochter, Bruder und die unverheiratete Schwester, die noch zu Hause wohnt.
Die biblische Bestimmung, dass um keine angeheiratete Verwandte, nicht einmal die eigene Ehefrau getrauert werden darf wie um die engsten Verwandten, hat schon der Talmud in Jewamot 22b korrigiert und die Ehefrau hinzugezählt. Da ein Kohen sich nicht im gleichen Raum mit einem Toten oder über einem Toten aufhalten darf, gibt es gerade in Israel viele Probleme. In orthodoxen Krankenhäusern hat man die Schwierigkeit durch Baumaßnahmen entschärft, sodass Kohanim als Ärzte arbeiten können.
Angesichts der überaus hypothetischen Abkunft heutiger Kohanim erscheint ihr Status als halachische Fiktion, die umso überraschender ist, als dass sie mit den Rechten und Pflichten kollidiert, die den Kohanim als Juden zukommen. In manchen Gemeinden wurde mit den Kohanim schon im 19. Jahrhundert so verfahren, wie man nach 1919 mit dem Adel umging. In jedem Falle erinnert uns die Torat Kohanim, wie das Buch Wajikra auch genannt wird, an die Brüche unserer Geschichte und an die Paradoxien der Halacha.
Die Autorin ist Rabbinerin der Jüdischen Gemeinde zu Berlin.
Inhalt
Am Anfang des Wochenabschnitts Emor stehen Verhaltensregeln für die Priester und ihre Nachkommen. Ferner wird beschrieben, wie die Opfertiere beschaffen sein müssen. Außerdem werden kalendarische Angaben zu den Feiertagen gemacht: Schabbat, Rosch Haschana, Jom Kippur und die Wallfahrtsfeste Pessach, Schawuot und Sukkot werden festgelegt. Gegen Ende des Wochenabschnitts wird erzählt, wie ein Mann den Gottesnamen ausspricht und für dieses Vergehen mit dem Tod bestraft wird.
3. Buch Moses 21,1 – 24,23