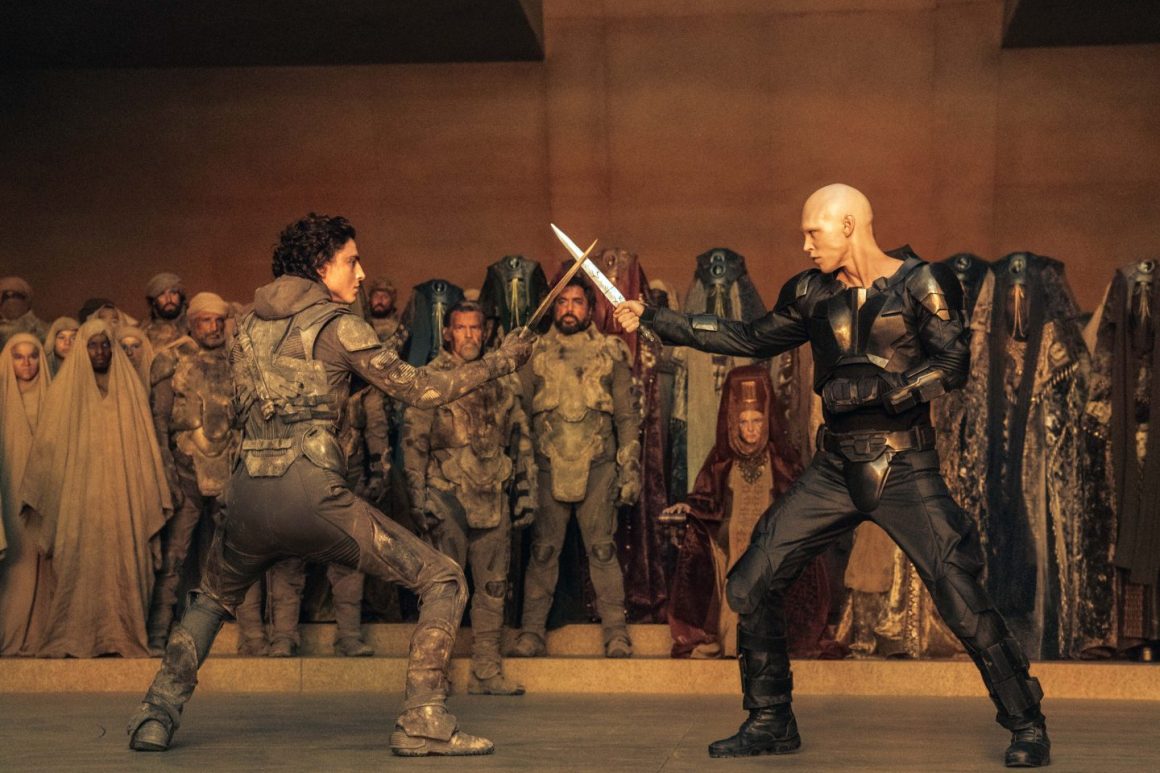Es ist der bisher erfolgreichste Filmstart des Jahres: Bereits am ersten Wochenende sind in Deutschland über 600.000 Menschen in die Kinos geströmt, um Dune: Part Two zu sehen. Der Streifen von Star-Regisseur Denis Villeneuve ist bereits die dritte vollständige Verfilmung des 1965 von Frank Herbert publizierten Sci-fi-Opus.
Nach dem Versuch des Avantgarde-Regisseurs Alejandro Jodorowsky, der unter anderem Salvador Dalí als Protagonisten und Pink Floyd für die Musik gewann, dann aber am Budget scheiterte, produzierte David Lynch 1984 die erste, stark kritisierte, Fassung. John Harrison setzte Dune im Jahr 2000 als Trilogie um. Mehr als 20 Jahre später hat Villeneuve seine szenische Interpretation des Werkes begonnen, deren zweiter Teil der geplanten Trilogie nun ebenfalls mit berühmter Besetzung in den Kinos läuft.
Die Geschehnisse auf dem Wüstenplaneten spielen mehr als 20.000 Jahre nach unserer Zeit, und inzwischen ist viel passiert: Mithilfe des bewusstseinserweiternden Spice, auch Melange genannt, sind Reisen im All einfacher möglich, und die Menschen haben sich das Universum angeeignet. Auch wenn sich vieles verändert hat, so blieb für Frank Herbert klar, was sich nicht ändern würde: die Sehnsucht der Menschen nach Religion. Für den Erschaffer der Reihe ist der Mensch »homo religiosus«. Damit unterscheidet sich Dune von vielen Science-Fiction-Werken wie Star Trek oder der Alien-Reihe.
Auch in ferner Zukunft sehnen sich die Menschen nach Religion.
Den Lesern (und Zuschauern) von Dune springen die Einflüsse aus allen erdenklichen Religionen entgegen: Als Grundlage vieler Religionen dient die ökumenische Orange Catholic Bible als heiliges Buch, das christliche und jüdische Texte kombiniert und Einflüsse aus dem Buddhismus und Islam vereint. Was dabei schnell auffällt, ist, dass Religionen nicht mehr in der Form bestehen, wie wir sie heute kennen. In den Tausenden Jahren haben sich die Religionen so stark verändert, an ihre Umwelt angepasst oder verbunden, dass es eine Vielzahl an synkretistischen Religionen und Kulten in Dune gibt.
Allgegenwärtige Sehnsucht nach dem Messias
Auch die Einflüsse des Judentums muss man nicht lange suchen: Am augenscheinlichsten ist die allgegenwärtige Sehnsucht nach dem Messias, dem Kwisatz Haderach. Die Schwesternschaft der Bene Gesserit züchtet menschliche Gene, um ebendiesen Messias hervorzubringen. Diese nach NS-Eugenik klingende Methode soll schlussendlich den Menschen mehr und mehr vervollkommnen. Abgeleitet hat Autor Frank Herbert den Terminus von dem talmudischen Ausdruck »Kefisatz Haderach«, der »Abkürzung des Weges« bedeutet.
Zudem erinnert das auf dem Wüstenplaneten lebende Volk der Fremen, das seit Generationen in der unwirtlichen Wüste siedelt, an die jüdische Geschichte. Es kann einerseits als Gleichnis auf die aus Ägypten ziehenden Israeliten gereichen, die 40 Jahre in der Wüste lebten. Andererseits erinnert die Szenerie an die Anfänge des modernen Israel, als aus den Kibbuzim heraus ein neuer Staat gegründet wurde.
Auch das von den Bene Gesserit kultivierte Mantra »Ich darf keine Angst haben! Die Angst tötet den Geist« hört sich an wie ein Echo des Psalms 23: »Selbst wenn ich im Tal des Todesschattens gehe, fürchte ich nichts Böses.«
Judentum in expliziter Form
Den ganz aufmerksamen Lesern der Bücher, die sich bis zum sechsten, dem letzten von Frank Herbert verfassten Band durchschlagen, begegnet das Judentum in expliziter Form: Hier erscheinen plötzlich Juden, die den Schabbat feiern, und ein Rabbi, der seine Gemeinde »in der Zerstreuung« geführt hatte – ein Synonym für die Diaspora.
Das liest sich gar nicht mehr nach formveränderter Religion und Synkretismus. Das ist ein aus der heutigen Zeit gegriffenes Judentum. Gerade die jüdische Religion stellt das einzige Gegenbeispiel zu den synkretistischen Religionen in Dune dar. Weshalb die jüdische Gemeinde sich abgesondert hatte, wird im Buch beschrieben.
Im sechsten Teil tauchen jüdische Gemeinden auf, mit eigenen Planeten.
»Sie haben vor langer Zeit eine defensive Entscheidung getroffen. Die Lösung für wiederkehrende Pogrome war, aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Die Raumfahrt machte dies nicht nur möglich, sondern auch attraktiv. Sie versteckten sich auf zahllosen Planeten – ihrer eigenen Verstreuung – und haben wahrscheinlich Planeten, auf denen nur ihr Volk lebt. Das bedeutet nicht, dass sie uralte Praktiken aufgegeben haben. Die alte Religion wird sicher weiterbestehen, wenn auch in etwas veränderter Form. Es ist wahrscheinlich, dass ein Rabbiner aus alten Zeiten sich hinter der Schabbat-Menora eines jüdischen Haushalts in eurer Zeit nicht fehl am Platz fühlen würde.«
Unveränderbarkeit als Trope der christlichen Substitutionslehre
Die gleichbleibende Form des Judentums, die Unveränderbarkeit, ist eine alte Trope der christlichen Substitutionslehre, nach der sich Juden nicht verändern können. Als vermeintlich nicht mehr gegenwartsnahe Religion ist ihre Zeit vorüber, sie sind stehen geblieben. Im Gegensatz dazu wurde das Christentum als Erneuerung des alten Bundes gedacht. Als Ablösung des Bundes mit dem Volk Israel.
Die Unveränderbarkeit der Juden in Dune ist aber weitaus mehr als ein Relikt christlichen Antijudaismus. Es ist die Überzeugung, dass Menschengruppen trotz aller Unwägbarkeiten ihre Identität bewahren können. Allen voran sind es Jüdinnen und Juden, die gelernt haben, sich unter Zwang nicht assimilieren zu lassen, sondern gerade dann stolz ihre eigene Identität zu zeigen und zu bewahren.
In Dune zeigt sich Frank Herberts Faszination für Religionen im Allgemeinen und für die jüdische im Speziellen. Es lohnt sich daher nicht nur aus cineastischem Interesse, die Fortsetzung des ersten Films zu sehen. Auch aus christlicher, muslimischer oder jüdischer Perspektive bietet Frank Herberts religiös-synkretistisches Werk spannende Einblicke und jede Menge Diskussionsstoff.
Der Autor ist Kultur- und Religionswissenschaftler und arbeitet in der interreligiösen »Denkfabrik Schalom Aleikum« des Zentralrats der Juden.