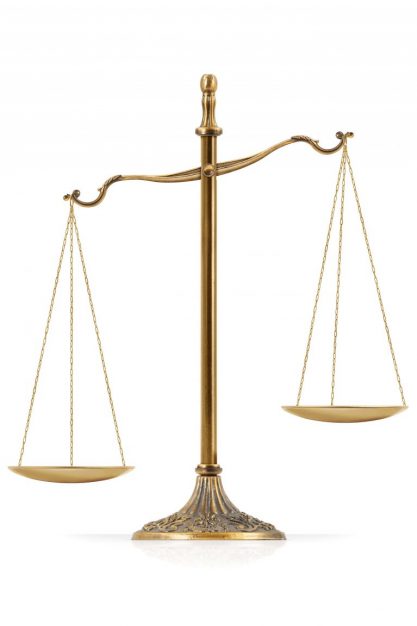Haben Sie schon einmal von dem unbarmherzigen oder rächenden G’tt des sogenannten Alten Testaments gehört? Wahrscheinlich schon, schließlich ist es eines der ältesten Vorurteile. Besonders beliebt war die Variante, den zornigen, rächenden G’tt der Tora dem barmherzigen, liebenden G’tt des Neuen Testaments gegenüber zu stellen.
Hier der primitive, barbarische G’tt des Judentums, dort der kultivierte, gnädige G’tt des Christentums. Dieser behauptete Gegensatz ist zwar falsch, aber eben auch uralt – und funktioniert vielleicht deswegen auch heute noch.
gegenüberstellung Jedenfalls habe ich mich bei dieser Gegenüberstellung schon immer gefragt, wie man es schafft, simple Grundregeln der Logik vollkommen außer Kraft zu setzen, um das Gegenüber schlecht zu machen. Denn eines ist doch wohl klar: Wenn es nur einen einzigen G’tt gibt – und daran glauben ja alle Monotheisten –, dann ist der jüdische G’tt haargenau derselbe wie der christliche. Denn es gibt ja nur einen! Einer für alle und alle für einen sozusagen.
Der oft behauptete Gegensatz zwischen dem »G’tt der Rache« und dem »G’tt der Liebe« ist falsch.
Da es aber nichts gibt, was es nicht gibt, gibt es auch Menschen, die das anders sehen wollen. Und zwar eine ganze Menge. Einer der frühesten und prominentesten Verfechter der Idee, dass die Werte von Judentum und Christentum so unterschiedlich seien, dass sie nicht als Anbetung eines einzigen G’ttes angesehen werden könnten, war Marcion, der im zweiten Jahrhundert n.d.Z. lebte.
Dieser behauptete, dass das Christentum ausschließlich auf dem Boden des Neuen Testaments stehe, während das Alte Testament überhaupt keine heilige Schrift sei. Marcions Vorstoß wurde zwar abgelehnt und als Häresie gebrandmarkt, doch die Samen seines Denkgebäudes waren ausgebracht – und damit die Möglichkeit, G’tt gewissermaßen zu spalten: hier der grimmige, unbarmherzige und rächende G’tt des Judentums und dort der gnädige, liebende und verzeihende G’tt des Christentums.
LEID Das Leid, das diese Idee im Laufe zweier Jahrtausende über die Juden gebracht hat, lässt sich nicht ermessen. Denn nachdem der G’tt der Rache erst einmal geschaffen war, brauchte es nur einen kleinen Schritt, um auch den Vertretern dieses G’ttes, also den Juden, die Eigenschaft der Rachsucht anzudichten.
Selbst Kenner der Materie verweisen in diesem Zusammenhang gern auf das biblische »Auge um Auge, Zahn um Zahn« und leiten daraus fälschlicherweise ein Racheprinzip ab. Dass dies absoluter Humbug ist und die Passage stattdessen eine historische Revolution war, ist schon unzählige Male erklärt worden. Mit mäßigem Erfolg. Was wohl daran liegt, dass Menschen in aller Regel das glauben, was sie glauben wollen. Und was obendrein daran liegt, dass – wie es Albert Einstein ausdrückte – ein Vorurteil schwerer zu spalten ist als ein Atomkern.
Aber Moment: Gibt es denn nicht auch Passagen in der Tora, in denen es konkret um Rache geht? Doch, die gibt es! So heißt es etwa im 5. Buch Mose 32,35: »Mein ist die Rache und die Vergeltung.« Und an anderer Stelle heißt es: »Preiset jauchzend, Nationen, sein Volk; denn das Blut seiner Knechte rächt Er, und Rache erstattet Er seinen Feinden« (5. Buch Mose 32,43).
gegenteil An wieder anderer Stelle jedoch steht genau das Gegenteil. So heißt es im 3. Buch Mose: »Du darfst keine Rache üben und nicht nachtragend sein« (19,18). Aber wie kann das sein? Wie kann G’tt einerseits mit Rache oder Vergeltung in Bezug gesetzt werden, wenn er die Rache an anderer Stelle eindeutig verbietet?
Bei genauem Hinsehen wird klar, dass sich das Racheverbot aus dem 3. Buch Mose auf uns Menschen bezieht. Das jüdische Gesetz ist also mit Blick auf uns Menschen glasklar: Rache ist verboten. Punkt. Aus. Wie aber sieht es mit G’tt aus? Kann es sein, dass G’tt uns Rache verbietet, sich aber selbst von dem Verbot ausnimmt? Und bedeutet das dann nicht, dass an dem rächenden G’tt vielleicht doch mehr dran ist, als wir wahrhaben möchten?
Die Tora verbietet den Menschen die Rache – sie bleibt G’tt überlassen.
Immer langsam. Denn wie heißt es so schön: »Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!« Und diese Vorsicht gilt es auch zu wahren, bevor man mit Blick auf G’tt oder die Tora voreilige Schlüsse zieht.
KONTEXT Zunächst darf neben einer präzisen Übersetzung in keiner Sprache der Zusammenhang, in dem Worte gebraucht werden, unberücksichtigt bleiben. Sprich: Der Kontext entscheidet! Und dies gilt natürlich auch hier.
Denn es gibt ja durchaus unterschiedliche Spielarten der Rache. Es gibt die niedere Eigenschaft primitiver Rachsucht oder die positive Variante der Vergeltung, welche der Gerechtigkeit als Grundlage dienen kann. Es gibt die unkontrollierte, übermäßige Rache, und es gibt die maßvolle und angemessene Vergeltung, um begangenes Unrecht zu kompensieren.
Von dieser Warte aus gesehen, wird aus dem vermeintlichen unbarmherzigen »G’tt der Rache« schnell ein nachdenklicher, einfühlsamer, aber durchaus ernsthafter und mitunter auch strenger »G’tt der Vergeltung«.
nachsicht Abgesehen davon demonstriert der Ewige in zahllosen Situationen Nachsicht oder Langmut und lässt Verzeihung, Vergebung und Barmherzigkeit walten. Der Dichter Heinrich Heine brachte dies auf den Punkt, als er sagte: »G’tt wird mir vergeben. Das ist ja sein Beruf!« Eine einseitige, eindimensionale Zuschreibung ist also fehl am Platz!
Einen anderen Ansatz bieten der Religionswissenschaftler Jan Assmann und der Philosoph Henri Atlan. Assmann etwa erklärt, dass in vielen frühen Zivilisationen der König g’ttliche Eigenschaften annahm. Er wurde zum Maß aller irdischen Dinge. Sein Zorn war gewissermaßen G’ttes Zorn, und seine Rache war sozusagen G’ttes Rache. Dadurch rechtfertigte der König sein Handeln mit G’tt. Und die Gewalt, die er ausübte, erhielt so eine religiöse Bestätigung.
Heinrich Heine sagte: »G’tt wird mir vergeben. Das ist ja sein Beruf!«
In der Hebräischen Bibel hingegen sah es ganz anders aus. Hier war die Distanz des Menschen zu G’tt unüberbrückbar. Und deshalb musste der Zorn theologisiert werden. Er musste gewissermaßen von der Erde auf den Himmel übertragen werden. Auf gut Deutsch: Für uns Menschen gibt es keinerlei g’ttliche Rechtfertigung, um unsere primitive Rachsucht zu befriedigen.
kalkül Henri Atlan schlägt in eine ähnliche Kerbe und meint, dass die Gewalt am besten dadurch aus der Welt vertrieben werden kann, dass man sie auf eine Transzendenz, also auf etwas Überirdisches, überträgt. Die Rache wird also vollständig aus dem menschlichen Kalkül entfernt. Oder einfacher ausgedrückt: G’tt und nicht der Mensch ist nach seiner Ansicht berechtigt, Gewalt auszuüben. Er ist es, auf den man seine Rachegelüste auslagern kann. Und er muss dann sehen, was er daraus macht.
Das heißt, dass man menschliche Rachegefühle durchaus anerkennt und das Verlangen nach Strafe, nach Vergeltung, ja nach ultimativer Gerechtigkeit seinen berechtigten Platz hat. Der Mensch ist schließlich ein komplexes Wesen und beherbergt viele, oftmals auch widersprüchliche oder primitive Empfindungen. Und obwohl es ein biblisches Ideal gibt, dem es nachzueifern gilt, schlägt die Realität nicht selten mit solcher Grausamkeit zu, dass das Ideal schier unerreichbar scheint.
Stellen Sie sich die unzähligen Juden vor, die im Laufe der Geschichte unsagbares Leid erfuhren, die mit ansehen mussten, wie ihre Liebsten gequält, gefoltert und ermordet wurden. Und fragen Sie sich selbst, ob in solchen Momenten Liebe, Vergebung oder Verzeihung ernsthaft die dominierenden Kräfte sein können. Ja, ob sie es überhaupt jemals sein sollten. Oder ob das brennende Verlangen nach Vergeltung, nach Recht und nach Gerechtigkeit nicht nach anderen Wegen verlangt.
RECHTSSYTSTEM Neben der Hoffnung und dem Vertrauen auf ein funktionierendes und gerechtes Rechtssystem bleiben jedenfalls nur wenige gewaltlose Alternativen. Der Weg des Judentums ist es, G’tt mit dieser Aufgabe zu betrauen. Das Verlangen nach ultimativer Gerechtigkeit auf den Ewigen zu übertragen. Von der Erde in den Himmel. Vom Menschen zum Ewigen. In dem Vertrauen darauf, dass er die geeigneten Mittel wählt, um Gerechtigkeit walten zu lassen.
Worum es in letzter Konsequenz also geht, ist die Hoffnung auf den ultimativen Ausgleich erlittenen Unrechts, die Sicherstellung endgültiger und vollkommener Gerechtigkeit. Es geht um Recht, nicht um Rache.
Der Autor ist Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen.