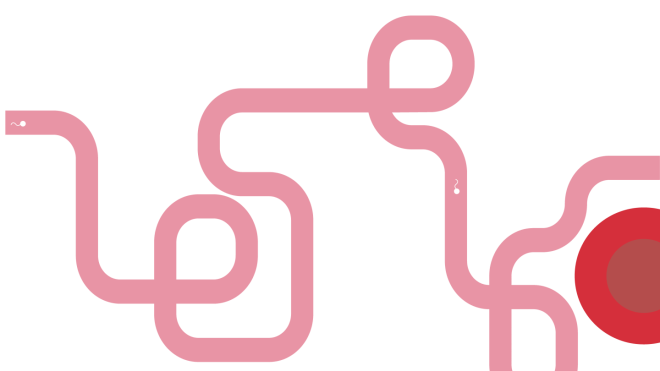»Und Gott erinnerte sich an Sara«, so beginnt die Toralesung am ersten Tag von Rosch Haschana. Gott erinnerte sich, dass er Sara ein Versprechen gegeben hatte: Nach Jahrzehnten des Wartens sollte sie ein Kind bekommen. Mit stolzen 90 Jahren gebärt Sara ihren ersten und einzigen Sohn, Jizchak.
Auch die anschließende Haftara-Lesung handelt von einer Frau, der Gott »den Mutterschoß verschlossen hatte«. Im Text wird eindrücklich beschrieben, wie sehr sie darunter leidet: »Chana, warum weinst du, und warum isst du nicht? Warum ist deinem Herzen weh?«
In ihrem Elend fleht Chana so inbrünstig zu Gott, dass die anderen sie für eine Betrunkene halten. Doch Gott erhört ihre Stimme, sie wird schwanger. Im Talmud wird eine dritte Frau erwähnt, deren langjähriger Wunsch nach einem Kind am Neujahrstag endlich erfüllt wird: Rachel.
Die Schriften scheinen uns auf eine Verbindung des Motivs des unerfüllten Kinderwunsches zum jüdischen Neujahrstag aufmerksam zu machen: Rosch Haschana ist der Tag, an dem Gott den Menschen erschaffen hat. Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, wiederholt sich dieses Schöpfungswunder im Kleinen.
Der Feiertag ist also mit dem Ideal verbunden, die Welt mit Nachkommen zu füllen – aber auch mit seiner realen Kehrseite, wie die Texte, die wir am ersten Tag in der Synagoge lesen, eindeutig belegen.
Das allererste Gebot an Adam und Chawa, das Gott gegenüber Noach nach der Sintflut in nahezu identischer Sprache wiederholt, lautet: »Seid fruchtbar und mehret euch!« Und doch setzt sich die Geschichte fort als eine von Frauen, die schreckliche Angst haben, nie Kinder bekommen zu können, sich allerlei haarsträubende Tricks überlegen, um Nachkommen zu zeugen, und die erst im hohen Alter Mütter werden.
Die große Verantwortung, die jüdische Geschichte fortzuschreiben, spüren Jüdinnen und Juden bis heute. Sie hat sich durch die zahlreichen Vernichtungsversuche, die dieses Volk ertragen musste, noch verstärkt. Kinder zu bekommen und eine jüdische Familie zu gründen, ist selbst unter weniger religiösen Juden ein hochgehaltener Wert. Das zeigt sich auch in den Zahlen: Israels Geburtenrate ist die höchste unter allen OECD-Staaten. Selbst säkulare Paare bekommen hier mehr Kinder als in ähnlich entwickelten Staaten.
Erst seit wenigen Jahren thematisieren vor allem religiöse, jüdische Frauen offen, was es bedeutet, wenn diese Verantwortung zur unerfüllbaren Last wird. Wenn es auch mit In-vitro-Fertilisation und Samenspende nicht klappt. Wenn die Frage, wann es denn endlich bei ihnen so weit ist, die Tränen in die Augen schießen lässt. Instagram-Kanälen wie »I was supposed to have a baby« folgen Zehntausende.
Gleichzeitig wird in modernen Gesellschaften das Kinderkriegen vollständig infrage gestellt: »Sollten wir angesichts der Klimakrise überhaupt noch Kinder bekommen?«, lautet hier vielleicht die radikalste Ansicht. Aber auch aus feministischer Perspektive lässt sich dieses Ideal hinterfragen: Frauen, die Kinder bekommen, erfahren den berühmten Karriereknick, sind statistisch häufiger im Alter von Armut betroffen und durchschnittlich unglücklicher als kinderlose Frauen.
Zu diesem Rosch Haschana erzählen zwei Jüdinnen aus Deutschland, was das biblische Ideal in modernen Zeiten für sie bedeutet.
Avital (38) aus München *
»Obwohl ich im Laufe meines Lebens eine immer stärkere Verbindung zur Religion entwickelte, habe ich mir nie ausgemalt, von einer großen Familie umgeben zu sein. Ich selbst bin Einzelkind, ebenso wie meine Mutter. Die jüdische Großfamilie war für mich kein vertrautes Konzept: Drei Kinder erschienen in der sowjetischen Blase, aus der meine Familie kommt, schon außergewöhnlich. Selbst später, im jüdischen Umfeld in Deutschland, war es nicht üblich, dass Familien viele Kinder hatten.
Dennoch war mir immer klar, dass ich Mutter werden wollte. Es gab Zeiten, in denen ich Zweifel hatte, ob ich eine gute sein würde. Viele Menschen versicherten mir, dass ich eine wunderbare Mutter wäre, was ich oft als Projektion empfand. Manchmal sehen andere etwas in dir, das du selbst nicht siehst.
Ich wurde nicht halachisch-jüdisch geboren, habe aber eine starke jüdische Tradition in meiner Familie und bin jüdisch erzogen worden. Für mich allein war es nicht nötig, einen formalen Übertritt zu machen, da ich niemandem, auch nicht mir selbst, beweisen musste, dass ich jüdisch bin. Aber mir war wichtig, dass meine Kinder nicht dieselbe Erfahrung des Ausschlusses innerhalb der jüdischen Gemeinde erleben würden, die ich durchgemacht habe. Ich wollte ihnen diese Herausforderung und den Schmerz ersparen, der mit der Frage ihrer jüdischen Identität verbunden sein könnte.
Und für mich war klar, dass ich mein Kind nach jüdischen Traditionen erziehen würde. Als ich meinen Mann kennenlernte, der ähnliche Herausforderungen in Bezug auf seine jüdische Identität hatte, beschlossen wir, gemeinsam den Prozess der Konversion zu beginnen. Es war für uns beide klar, dass wir dies sowohl für uns als auch für die Kinder, die wir haben wollten, tun würden. Es lag ein langer Weg vor uns.
Mit 27 fühlte ich, dass es an der Zeit war, ernsthaft über Kinder nachzudenken, aber wir waren noch weit davon entfernt, diese Statusanerkennung zu bekommen. Also haben wir gewartet. Ich habe gedacht: Wenn wir schon die Möglichkeit haben, ein nach der Halacha jüdisches Kind von beiden jüdischen Eltern zu bekommen, sollten wir das dann nicht auch tun?
Mein Mann ist jünger als ich und hatte ein anderes Zeitgefühl in Bezug auf das Vaterwerden und die Dringlichkeit dieser Frage. Zu einem gewissen Punkt war ich fast bereit zu sagen, dass wir vielleicht erst ein Kind bekommen und dann zu dritt konvertieren könnten. Ich hatte das Gefühl, dass jetzt eine gute Zeit wäre, aus vielen Gründen.
Wir diskutierten. Schließlich entschieden wir uns, das Thema nicht zu forcieren, aber ich setzte meine Verhütungsmittel ab, um meinen Körper hormonell darauf vorzubereiten, dass es bald losgehen könnte. Es dauerte noch einige Jahre, bis wir schließlich die Konversion abschließen konnten, in die Mikwe tauchten und die Familienplanung wirklich angingen.
Doch zu dieser Zeit hatte ich auch ein berufliches Projekt, das ich unbedingt abschließen wollte, und dachte, es wäre vielleicht nicht ideal, wenn ich vorher schwanger würde. Dies war nur ein weiterer Faktor unter vielen, den wir berücksichtigen mussten.
Wir glaubten die ganze Zeit daran, dass die Unterstützung von Gott kommen würde, wenn es unser Weg ist. Als es sich nicht so schnell und nebenbei ergab, wie wir es uns erhofft hatten, und wie es ja oft erzählt wird, nahmen wir es als Teil unseres Weges an. Gleichzeitig wollten wir uns nicht zu fatalistisch verhalten und glauben, dass alles nur in Gottes Händen liegt. Wir lernen ja aus unserer Tradition, dass wir auch selbst etwas zu unserem Glück beitragen müssen.
Wir erkundigten uns bei Freundinnen über ihre Erfahrungen in Kinderwunschkliniken und bereiteten uns darauf vor, falls eine Behandlung notwendig werden sollte. Wir hatten in unserem unmittelbaren Umfeld religiöse Paare, für die das schon früher eine Herausforderung war. Ich kannte eine viel jüngere Frau, die durch künstliche Befruchtung schwanger geworden war.
Und da kam natürlich schon die Frage auf: Habe ich den Moment verpasst? Damals mit 27, als ich diesen Kinderwunsch das erste Mal hatte, wäre es sicher leichter gewesen. Mein Mann hat sich krasse Vorwürfe gemacht, dass er es sozusagen nicht zum richtigen Zeitpunkt geschnallt hatte. Dass er damals das alles für nicht so dringend empfand. Nun war ich bereits Mitte 30. Mit den Ärzten klappte es mal schlechter, mal besser. Trotzdem fanden wir eine Klinik, die uns sehr gut betreute.
Aber auch dort funktionierte es nicht auf Anhieb. Einmal sah es so aus, als ob sich etwas eingenistet hätte, aber dann war es nicht mehr da. Das war ein Moment, der uns zwei ganz schön zum Verzweifeln gebracht hat, aber auch wieder zum Reflektieren. Wir hatten als Paar schon viele Prüfungen durchgestanden, wir durften jetzt nicht aufgeben. Ich finde auch, dass diese Zeit uns nähergebracht und einfühlsamer füreinander gemacht hat. Wir beide hatten mit Ängsten zu kämpfen und dem Gefühl des Versagens. Wir mussten füreinander einstehen.
Wir warteten sehnsüchtig und durchlebten einige Rückschläge, doch schließlich gelang es.
Im Nachhinein denke ich, wie wichtig es war, sich während dieser Zeit auszutauschen. Nicht nur für uns, auch für andere, von denen ich wusste, dass sie in der gleichen Situation steckten. Für viele war es überhaupt nicht selbstverständlich, wenn ich das von mir aus ansprach. Das Thema ist mit sehr viel Scham und Schmerz verbunden. Doch es ist so wichtig, füreinander da zu sein, besonders in einer Community von Betroffenen.
Ich habe meine Behandlung und die damit verbundenen Herausforderungen offen besprochen, um das Thema zu normalisieren. Es ist wie bei anderen Gesundheitsfragen – ich sehe keinen Grund, dies zu verbergen und sich keine Unterstützung zu suchen. Ich erkannte auch immer mehr, wie verbreitet das ist, und dass beinahe jedes Paar früher oder später vor diesen Herausforderungen steht.
«Alle fieberten mit, aber wir konnten keinen Treffer vorweisen. So fühlte sich das an.»
Auch in meiner Familie gibt es einen Fall, der lange Zeit ein Tabu war. Meine Großeltern wurden erst spät Eltern, und mein Großvater erzählte darüber eine Geschichte, die den Anschein erweckte, als sei dies nur deshalb so geschehen, weil sie erst spät heiraten konnten. Dann aber fanden wir heraus, dass zwischen Hochzeit und Kind fünf weitere Jahre lagen. Das ist so eine Story, die im Nachhinein irgendwie glattgestrichen wurde. Und ich glaube, sehr viele Familien haben derartige Geschichten.
In religiösen Kreisen gibt es oft die Erwartung, dass Paare nach der Hochzeit schnell Kinder bekommen sollen. Wenn Menschen erst in ihren 30ern heiraten, wird umso mehr erwartet, dass sie bald Eltern werden. Ich habe das schon bei meiner Hochzeit zu spüren bekommen, da werden einem dann viele Brachot gewünscht, aber jeder weiß, dass es um Fruchtbarkeit geht.
Diese Erwartungen führen dazu, dass man offenbar beobachtet und jeder Schritt in der Familienplanung bemerkt wird. Diese Blicke, die fragen, ob man nun schwanger ist oder nur zugenommen hat, erzeugen einen enormen Druck. Auch wenn die Aufmerksamkeit meist liebevoll gemeint ist, kann sie zusätzlichen Stress verursachen. Leute fiebern mit – aber du hast keinen Treffer vorzuweisen. So fühlt es sich an.
Eine wichtige Stütze für mich war meine Balanit, also die Frau, die einem Monat für Monat beim rituellen Tauchbad nach der Menstruation in der Mikwe hilft. Es war eine besondere Beziehung, da sie mich regelmäßig sah und meine Situation kannte, ohne dass ich ihr etwas erklären musste. Sie wusste von meinem Wunsch, eben nicht mehr jeden Monat zu ihr zu kommen. Die Mikwe-Besuche waren oft ein Ort der Reflexion und des Austauschs.
Ich habe auch große Unterstützung von meiner Rebbetzin erfahren. Zwar haben wir nicht direkt über alles gesprochen, aber ich habe stark gespürt, wie sehr sie und der Rabbiner mit uns mitgegangen sind.
Es war, als wären sie wie Eltern, die sich nicht trauen zu fragen, aber mit ganzem Herzen dabei sind. Als es schließlich geklappt hat, habe ich so viel Liebe und Freude gespürt, als ich ihnen die Nachricht überbrachte. Es fühlte sich an, als ob ich ihre eigene Tochter wäre, die ihnen ein Enkelkind schenkt.
Die enge Gemeinschaft kann manchmal herausfordernd sein, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht immer einfach ist, sich mit anderen zu vergleichen, die schneller schwanger wurden oder keine Schwierigkeiten hatten. Es kann sich wie ein Wettbewerb anfühlen. Aber die jüdische Gemeinschaft ist auch eine große Ressourcenkiste.
Ich möchte ein Beispiel nennen: Ich arbeite in einem sehr jüdischen Umfeld, von dem ich immer das Gefühl vermittelt bekommen habe, dass es völlig normal wäre, Kinder zu bekommen. Als ich verkündet habe, dass ich schwanger bin, hat mein Chef sich mit am meisten gefreut. Er hat sich für ein paar Wochen gar nicht einbekommen. Er hat schon in der Schwangerschaft immer ganz fürsorglich geschaut, ob ich gut sitze, genug esse, und so weiter.
Als ich dann in Mutterschutz ging, hat er mir die volle Freiheit gelassen, selbst zu entscheiden, wann ich wieder ins Büro komme. Als ich das erste Mal mit meinem Baby dort war, wollten es natürlich alle auf den Schoß nehmen. Auch wenn es im Zoom-Meeting weinte oder ich zu spät kam, weil ich noch stillen musste, wurde das vollkommen akzeptiert. Es gehört eben dazu.
Ich habe einige Freundinnen, denen es ganz anders geht und die die Frage nach Kind oder Karriere tatsächlich als Dilemma empfinden. Manchmal liegt das am Arbeitsplatz. Wer im Labor steht oder Nachtschichten hat, kann dort natürlich kein Baby mitbringen. Aber ich finde, es liegt auch an einer ganz besonderen Flexibilität und Offenheit von jüdischen Arbeitgebern, gerade wenn sie in der Community verwurzelt sind. Es gehört dort zum eigenen Selbstverständnis, Frauen mit Kindern nicht zu benachteiligen.
Und zum Thema jüdische Ressourcenkiste: Für mich war es sehr unterstützend, zu wissen, dass selbst unsere Erzmütter Schwierigkeiten hatten, schwanger zu werden, und dass darüber offen gesprochen wird. Chana war mir ein inneres Vorbild. Sie hat mir Mut gemacht zu wissen, dass ich nicht allein bin und dass Glaube und Handeln gemeinsam wirken müssen. Diese Einsicht, dass wir Unterstützung brauchen, sowohl von Haschem als auch von unserer Umgebung, hat mir viel bedeutet.
Es war wirklich hilfreich, dass ich bereits vor der Schwangerschaft alle wichtigen Karriereprojekte abgeschlossen hatte, was mir die erste Zeit mit dem Baby wirklich erleichterte. Auch die Gelassenheit, die ich durch das Alter und die Lebenserfahrung gewonnen habe, half mir. Ich konnte die Herausforderungen der Mutterschaft viel entspannter angehen. Vielleicht, denke ich heute, kam eben doch alles zur richtigen Zeit.«
Hannah (41) aus Osnabrück *
»Ich bin in einer eher unkonventionellen jüdischen Familie aufgewachsen. Den Druck, jüdisch zu heiraten und dann viele jüdische Kinder zu bekommen, gab es bei uns nicht. Und wenn, dann hätte ich mich dem bestimmt widersetzt. Ich hatte eigentlich keinen starken Kinderwunsch, doch dann wurde ich mit 31 schwanger, erlebte eine sehr schöne Schwangerschaft, und als ich das kleine Köpfchen mit der Hand berührte, das gerade aus mir herauskam, war das ein unglaublich intensiver Moment, weil ich das Wunder des Lebens spürte. Ich habe dann zur Hebamme gesagt: Das war so cool, ich will das noch einmal machen. Sie hat gelacht und gesagt, normalerweise höre sie das Gegenteil.
Mein Kinderwunsch wurde also erst ab dem ersten Kind richtig stark, und er vertiefte sich dann. Nur: Ich hatte keinen Partner mehr dafür. Vom Vater meines ersten Kindes hatte ich mich früh getrennt, es passte einfach nicht.
Warum wollte ich überhaupt Kinder? Die Welt, in die ich sie setze, ist schlecht, es gibt Kriege, Katastrophen. Aber es ist eigentlich ganz einfach: Was sollen wir denn sonst machen? Es liegt am Ende an uns, unseren Kindern die Werte weiterzugeben, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Und vielleicht ist mein Kinderwunsch auch ganz banal zu erklären, ich bin eben Ärztin: Unsere Körper sind dafür gemacht. Wir Frauen spüren, vielleicht früher und dringlicher als die Männer, dass es unsere Aufgabe ist, das Leben fortzupflanzen. Es ist ein innerer Trieb, eine tiefe Sehnsucht. Und ich glaube, wenn Menschen darauf verzichten oder aus anderen Gründen keine Kinder bekommen, werden sie häufig sehr unglücklich.
Ich habe Patientinnen, die sind sehr alt, und wenn ich frage: Haben Sie Kinder? Dann höre ich manchmal ein ganz tieftrauriges Nein. Kinder geben dem Leben ja unheimlich viel Sinn. Mit meinem ersten Kind habe ich auch eine Liebe gespürt, die ich vorher nicht kannte.
Und Kinder schweißen eine Familie erst richtig zusammen. Es ist Produkt der Liebe zweier Menschen. Es ist auch so das Wunder des Lebens. Das meine ich jetzt nicht religiös. Ich kann mit dem Gebot, viele Kinder zu bekommen, nicht viel anfangen. Aber gleichzeitig verleihen Kinder dem Leben einen tieferen Sinn. Sie sind ein Zeichen der Liebe des Bündnisses, des Zusammenseins. Wo wir wieder beim Partner wären.
Ich habe mich wie viele auf Onlinedating-Apps umgesehen und versucht, jemand Passenden für mich zu finden, der sich am besten auch noch ein Kind wünscht. Eigentlich war mir egal, ob er auch jüdisch ist. Es muss zwischenmenschlich passen. Gleichzeitig war mir aber auch wichtig, dass ich meine jüdischen Traditionen einbringen kann.
Mit dem Vater meines ersten Kindes war das schwierig, er war Muslim, und hatte natürlich auch seine Vorstellungen. Ich wollte unseren Sohn am achten Tag beschneiden lassen, er erst später. Am Ende hat er sich durchgesetzt.
Nach der Trennung habe ich meinen Sohn in den jüdischen Kindergarten geschickt. Unsere Religion hat viele gute Seiten. Als jüdisches Kind in Deutschland setzt du dich automatisch mit so vielen Themen auseinander, mit einem anderen Land, mit einem anderen Teil der Bibel, mit anderen Geschichten. Du hast noch eine andere Welt, in der du dich befindest, und ich denke, das ist bereichernd.
Auch wenn wir nicht religiös sind, ist es mir total wichtig, mit der Familie am Schabbat, an den Feiertagen zusammenzukommen, und dass mein Kind dann auch die Lieder laut mitträllert. Der Sedertisch ist doch viel schöner, wenn alle durcheinanderquasseln, wenn viel Leben da ist. Das Judentum ist schon sehr auf Familie ausgelegt.
«Ich freunde mich noch mit dem Gedanken an, dass mein neuer Partner keine Kinder will.»
Vor einem Dreivierteljahr habe ich dann meinen Partner kennengelernt. Er ist nicht jüdisch – das war mir nicht so wichtig. Aber er wollte keine Kinder mehr – das war schon komplizierter. Er hat bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung und meinte, er sei mit der Familienplanung durch. Er wollte seine Freiheit genießen. Das war hart für mich: Ich hatte endlich jemanden gefunden, den ich wirklich liebte und mit dem ich eine tolle Beziehung führen kann.
Aber ich musste mich von meinem Kinderwunsch verabschieden. Er hatte eine Vasektomie, da war also auch nichts mehr mit Überzeugungsarbeit zu machen. Sollte ich mich von ihm trennen? Oder konnte ich mich damit anfreunden, den Kinderwunsch durch andere Werte zu ersetzen?
Meine Karriere als Ärztin liegt noch vor mir, ich kann einige Stufen erklimmen, und ich liebe meinen Job. Ich hätte dann auch mehr Zeit für unsere Partnerschaft, wir könnten reisen. Ich versuche, mich noch mit diesem Gedanken anzufreunden.
Vor Kurzem habe ich eine Israelin in Deutschland kennengelernt. Sie hat Zwillinge und einen hohen Posten in einem Unternehmen. Und ja – sie hat keinen Partner. Sie hat sich in Israel künstlich befruchten lassen und ist hierhergekommen, um ihre Karriere zu starten. Unglaublich!
Ich finde das sehr stark. Die Medizin schafft so ein befreiendes Moment für uns Frauen. Eine Oberärztin von mir hat sich kürzlich die Eizellen einfrieren lassen, eine andere Freundin nahm sieben Mal eine künstliche Befruchtung vor, bis es geklappt hat. Mit einem Mann wäre es sicher auch nicht einfacher gewesen. Und jetzt ist dieses Kind ihr Leben.
Sich so etwas zu trauen, ist sehr israelisch. Dort ist das auch viel normalisierter. Jeder will Kinder haben, das ist nicht mal eine Diskussion! In Israel werden künstliche Schwangerschaften sogar vom Staat subventioniert, bis man 45 Jahre alt ist. Das finde ich eine gute Zahl. Ich habe mir immer gedacht: Wenn ich bis 45 kein Kind bekommen hätte, dann hätte ich mich auch künstlich befruchten lassen.
Gleichzeitig weiß ich, wie schwer es war, ein Kind ganz allein aufzuziehen. Das will ich nicht noch einmal. Eine Familie ist eben das logischste und pragmatischste Modell, wie ein Kind gut aufwachsen kann. Und mit einem Partner ist vieles einfacher. Man teilt sich die Aufgaben, das Einkommen. Aber dafür muss man eben erst einmal einen Partner finden, der das mitmacht. Und ja, jetzt habe ich einen Partner, der das nicht will. Und den ich sehr liebe.
Natürlich könnte ich mich unter großem Herzschmerz trennen und weitersuchen. Aber wer sagt, dass das mit 41 so einfach ist? Zumal ich ja nicht irgendjemanden suche. Ich hatte zuvor einen Partner, der unbedingt Kinder wollte, aber zwischen uns hat es nicht gepasst. Da war nicht so viel Liebe. Die habe ich jetzt. Und vielleicht reicht es mir auch, und ich gewöhne mich daran, dass nun eine andere Lebensphase beginnt. Ich finde aber, das ist wirklich keine leichte Entscheidung.«
Die wirklichen Namen und Wohnorte der Frauen sind der Redaktion bekannt.