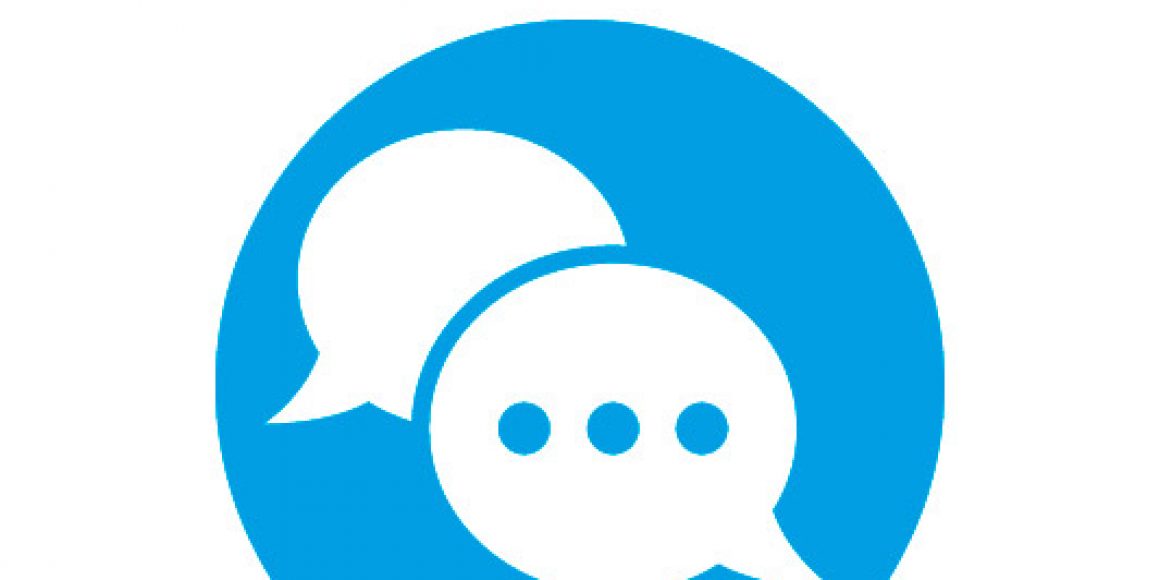Es gilt als unhöflich, nach einer Zusammenkunft wortlos auseinanderzugehen. Im deutschsprachigen Raum pflegt man beim Abschied zu sagen: »Man sieht sich« oder »Auf Wiedersehen«. Dies sagt man auch in solchen Fällen, wenn beide Seiten nicht die geringste Absicht haben, sich noch einmal zu treffen.
Babylonische Amoräer, die stets das Denken an die Tora fördern wollten, haben statt nichtssagenden Floskeln ganz andere, sinnvolle und abwechslungsreiche Abschiedsworte vorgeschlagen. So lesen wir im Traktat Berachot: »Mari lehrte: Man verabschiede sich von seinem Nächsten nicht anders als mit einem Dwar Halacha, einer Halacha-Erörterung, denn dadurch gedenkt er seiner« (31a).
Dwar Halacha Der Talmud erklärt ausdrücklich, was beim Abschiednehmen unerwünscht ist: »Man verabschiede sich nicht von seinem Nächsten im Geplauder, noch im Scherzen, noch in leichtfertigem Treiben, sondern mit einem Dwar Halacha.« Maris Lehrsatz versteht sich nicht von selbst, er bedarf einer Erklärung. Wie bewirkt das Aufsagen eines Dwar Halacha, dass der andere Mensch seiner gedenkt? Um diese psychologische Frage zu beantworten, müssen wir zuerst klären, was genau der Begriff »Dwar Halacha« meint. Die wörtliche Übersetzung lautet: »Wort der Halacha«. Doch diese Übersetzung trifft nicht hundertprozentig das, was Mari wirklich gemeint hat.
Dass Dwar Halacha nicht alle Worte der Halacha umfasst, macht uns eine andere Vorschrift deutlich, die auf derselben Talmudseite steht: »Die Rabbanan lehrten: Man stelle sich nicht zum Beten hin nach einer Rechtsverhandlung und auch nicht nach einer Halacha-Erörterung (Dwar Halacha), sondern nach einer abgeschlossenen Halacha (hebräisch: Halacha pesuka).«
Raschi (1040–1105) erklärt in seinem Kommentar zu dieser Stelle, was die Besonderheit einer Halacha pesuka ist: Sie bedarf keiner weiteren Betrachtung, sodass der Beter während des Gebets nicht an diese Halacha denken wird. Nun dürfte uns klar geworden sein, warum man nach einem Dwar Halacha nicht gleich beten soll. Beim Beten soll man sich auf die Worte des Gebets konzentrieren; wenn jemand aber noch über eine ungeklärte halachische Frage nachdenkt, kann er nicht mit der erforderlichen Andacht beten.
Es ist also zwischen einer Halacha pesuka und einem Dwar Halacha zu unterscheiden. Bei beiden geht es um religionsgesetzliche Fragen. Ist die Sache klar und bedarf keiner weiteren Erörterung, so haben wir eine abgeschlossene Halacha vor uns – diese wird die Andacht beim Beten in der Regel nicht gefährden. Hingegen besteht bei einem Dwar Halacha noch Klärungsbedarf. Die Unabgeschlossenheit einer halachischen Frage beschäftigt uns weiter, hält uns mehr oder weniger in ihrem Bann. Für die Erinnerung an denjenigen, der uns das halachische Problem vorgetragen hat, ist dies gewiss sehr förderlich.
Zeigarnik-Effekt Maris oben angeführte Feststellung, mit einem Dwar Halacha beim Abschied bewirke man, dass der Gesprächspartner seiner gedenke, ist von der modernen Psychologie bestätigt worden. Im Rahmen der Gestalttheorie Kurt Lewins (1890–1947) ist der sogenannte Zeigarnik-Effekt entdeckt worden. Er besagt, dass man sich an unerledigte Aufgaben besser erinnert als an abgeschlossene, erledigte Aufgaben.
Wie kommt dieser Effekt zustande? Jede angefangene Aufgabe baut eine Spannung auf, die mit dem Abschluss der Aufgabe abgebaut wird. Wird der Spannungsabbau jedoch verhindert, bleibt durch die bestehende Spannung der Inhalt leichter verfügbar, und man erinnert sich besser daran.
Der Talmud weiß um den Zeigarnik-Effekt und leitet ganz im Sinne der Gestalttheorie ab, was man beim Beten vermeiden sollte und was beim Abschiednehmen zweckmäßig und wünschenswert ist.