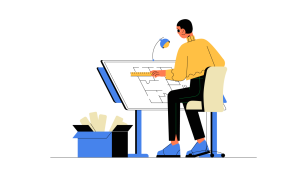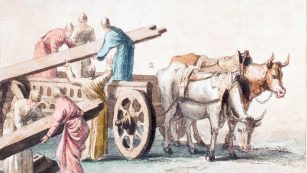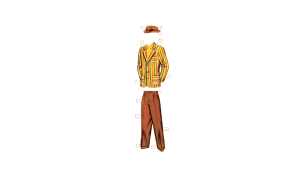Ab dem 1. April sind der Anbau und der Konsum von Cannabis in Deutschland unter Einschränkungen legal. Lange wurde darüber in der Politik diskutiert, vor allem, weil Zweifel an der Umsetzung von Abstandsregelungen und Altersgrenzen bestanden. Doch auch aus religiöser jüdischer Sicht kann man durchaus kontrovers darüber diskutieren. Wenn nun das deutsche Gesetz nicht mehr im Weg steht: Wie regelt die Halacha den Konsum von Cannabis?
Die Debatte eignet sich hervorragend, um das jüdische Religionsgesetz einmal näher zu betrachten und seine Struktur sowie mögliche Grenzen der Halacha zu diskutieren.
Woher kommen überhaupt Ge- und Verbote im Judentum?
Das orthodoxe Judentum geht davon aus, dass der Text der fünf Bücher Mose wörtliche und unveränderte Offenbarung des einen allmächtigen Gʼttes ist. Dieser Text enthält nach Rabbi Simlaj 248 Gebote und 365 Verbote. Neben der schriftlichen Tora, so die jüdisch-orthodoxe Auffassung, hat Mosche am Berg Sinai aber auch noch eine mündliche Offenbarung erhalten. Diese enthält Regeln der Interpretation zu den Versen und Geboten der schriftlichen Tora.
Ein Beispiel ist der berühmte Vers »Auge um Auge, Zahn um Zahn«. Im ersten Augenblick mag man denken, es handele sich hier um einen Aufruf zu Rache und Gewalt, die mündliche Information zu diesem Vers erklärt aber die wahre Bedeutung: Es geht vielmehr um einen Aufruf zu Schmerzensgeldzahlungen, die äquivalent zum verursachten Schaden sein sollten.
Es gilt: Halte dich an das Gesetz deines Landes. Doch das ändert sich.
Nach dem Beginn des Exils begann die Verschriftlichung der mündlichen Tora, um diese vor dem Vergessen zu schützen. Das Werk, in dem die mündliche Tora kryptisch und knapp festgehalten wurde, heißt Mischna (2. Jahrhundert d.Z.), diese wird in der Gemara (4. bis 5. Jahrhundert d.Z.) diskutiert. Die Mischna mit der Gemara zusammen bilden den Talmud.
In der jüdischen Geschichte tauchten immer wieder Fragen auf, die nicht direkt in der Tora oder im Talmud besprochen werden. In solchen Fällen wurden Rabbiner aufgesucht und gefragt, welcher Weg aus Sicht der Tora der Beste sei. Die Rabbiner beantworteten die Fragen in Anlehnung an Tora und Talmud in einer sogenannten Teschuwa (deutsch: Antwort).
Zu einer Frage, die nicht klar in der Tora oder im Talmud festgeschrieben ist, können verschiedene Rabbiner also verschiedene Teschuwot geben. All die unterschiedlichen Antworten ergeben die Meinungspalette, die im Rahmen der Halacha möglich wird. Die Halacha, das jüdische Religionsgesetz, ist dabei die Gesamtheit der praktischen Regelungen für das Handeln im Sinne der Tora. Eine halachische Meinung wird vor allem durch die persönliche Autorität des Rabbiners bestimmt. Es gibt keine Institution, die entscheiden würde, welche Meinung mehr Gehör finden sollte als die andere.
Wenn wir uns also die Frage stellen, ob Cannabiskonsum aus Sicht der Halacha erlaubt ist, dann müssen wir uns die oben beschriebenen Ebenen anschauen: Tora, Talmud und Teschuwot.
Manche behaupten, Cannabis werde in der Tora erwähnt
Cannabiskonsum wird in der Tora selbst nicht thematisiert. Es gibt einzelne Forscher, die glauben, dass die beschriebene Zutat des Salböls im Tempel, »Keneh Bosem«, Cannabis sein könnte. Etymologisch bedeutet das so etwas wie »aromatische Kräuter«. Das ist jedoch nur eine Theorie und betrifft auch kein Ge- oder Verbot des Konsums.
Der Talmud jedoch verbietet es, das Gesetz des Landes, in dem man lebt, zu brechen, solange das Gesetz nicht der Tora widerspricht. Cannabis ist in Deutschland also auch aus religiöser Sicht so lange verboten, bis der Staat es erlaubt. Dies ist ab 1. April – zumindest für die Erwachsenen – der Fall.
Im 20. Jahrhundert sind sich die Rabbiner noch weitgehend einig. Nun aber gibt es Zweifel an der alten Ablehnung von Cannabis.
Auf der Ebene der Teschuwot ist die wohl berühmteste und autoritärste Meinung zum Konsum von nichtmedizinischem Cannabis die Meinung von Rabbi Mosche Feinstein. Feinstein, der zu seiner Zeit als größter Rabbiner der USA galt, verbot in einer Teschuwa aus dem Jahr 1973 den nichtmedizinischen Cannabiskonsum aus sieben Gründen, die er direkt in der Tora verankert sieht: 1. Das Konsumieren von Cannabis schadet der Gesundheit. 2. Es stört die Entscheidungsfähigkeit. 3. Es macht unfähig zum Beten und zum Erfüllen der Gebote Gʼttes. 4. Es kann süchtig machen. 5. Es ist respektlos gegenüber den Eltern, da die eigenen Eltern ihrem Kind nicht wünschen würden, dass es Cannabis konsumiert. 6. Man übertritt das gʼttliche Gebot, sich zu heiligen. 7. Der Zustand der Benebelung kann zu einer Vielzahl von anderen Sünden führen.
Andere Suchtmittel wurden von den Rabbinern erlaubt
Unter den orthodoxen Rabbinern des 20. Jahrhunderts ist die Meinung, dass Juden kein Cannabis konsumieren dürfen, absoluter Konsens. Auch der berühmte israelische Rabbiner Schlomo Zalman Auerbach und der Lubawitscher Rebbe vertraten diese Ansicht. Im Jahr 2018 sagte Rabbiner Finkelstein, ein Experte für die Schriften Rabbiner Feinsteins, dass die 1973 veröffentlichte Teschuwa nicht aus validen Argumenten bestehe und daher nicht mehr vertretbar sei.
So sieht er das Gesundheitsrisiko nicht höher gegeben als bei Alkohol oder Tabak, das Hirn wird nicht langfristig zerstört, die Suchtgefahr ist nicht größer als bei anderen Substanzen. Außerdem sei das Gebot, die Eltern zu ehren, nur auf direkte Ehrung und Entehrung der Eltern anwendbar, nicht auf jede einzelne Handlung, welche die eigenen Eltern vielleicht unangemessen finden.
Rabbiner Finkelstein sieht die starke Ablehnung von Cannabis vor allem durch die Assoziation der Substanz mit dem wahrgenommenen freizügigen und unfrommen Verhalten der Studentenbewegungen der damaligen Epoche verbunden.