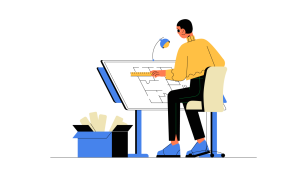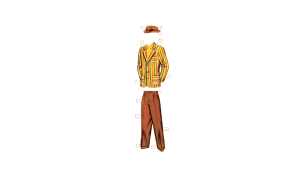Warum heilt G’tt keine Amputierten?» Die Frage, um die es hier gehen soll, wurde mir in einem Chat auf Facebook gestellt – und ist im Grunde nur eine weitere Version der alten Frage der Theodizee (altgriechisch für Gerechtigkeit oder Rechtfertigung G’ttes): Wenn es G’tt gibt und Er gütig ist, wieso gibt es dann so viel Leid auf Erden?
Dieser scheinbare Widerspruch gilt nicht nur als «Fels des Atheismus», sondern ist seit eh und je eine der großen Fragen der Religion. Er ist auch zum Thema des 92. und des 73. Psalms geworden: «Ewiger, wie sind Deine Werke so groß! Deine Gedanken sind so sehr tief. Ein Törichter versteht das nicht, und ein Narr begreift solches nicht, dass die G’ttlosen grünen wie das Gras, und die Übeltäter blühen alle ...» (Psalm 92, 5–7).
Duett Der Ausdruck «ein Törichter» (Isch ba’ ar), im Zusammenhang mit dem Verb lada’at (wissen oder verstehen) kommt ebenfalls im 73. Psalm vor, wo der Psalmist bekennt: «wa-ani ba’ar, lo eda» – «Siehe, das sind die Gottlosen; die sind glücklich in der Welt und werden reich. Ich hätte auch schier so gesagt wie sie ... da war ich ein Törichter und wusste nichts; ich war unwissend wie ein Tier vor Dir» (Psalm 73, 12–23).
Vermutlich bilden diese beiden Psalmen mit Absicht ein Duett, denn ansonsten kommt der Ausdruck ba’ar in Kombination mit dem Verb lada’at in den Psalmen nicht vor. In beiden Texten setzt sich der Psalmist mit dem Thema der Theodizee auseinander. Im 73. Psalm wankt er beinahe in seinem Glauben; im 92. Psalm zeigt er sich standfester.
Paradox Die Frage bleibt: Wenn G’tt alles kann und unsere Vorfahren mithilfe von Wundern aus Ägypten herausführte, wieso sehen wir solche klaren und eindeutigen Wunder seit Jahrtausenden nicht mehr? Laut einer Erklärung des Talmud (Berachot 7a) war es genau dieses Paradox, um dessen Aufklärung Mosche G’tt bat, als er sagte: «Lass mich Deine Wege erkennen» (2. Buch Mose 33,13).
Nach einer gängigen Interpretation entsprach G’tt dieser Bitte, nach einer anderen Auffassung von Rabbi Meïr und Rabbi Jehoschua Ben Korcha verweigerte G’tt die Lösung, «denn es hat Mich kein Mensch gesehen und ist am Leben geblieben» (2. Buch Mose 33, 19–20).
Wir können also keine definitive Antwort finden – denn wir sind ja auch nur Mitglieder der lebendigen Menschheit. Manche Leute suchen ihre Antwort auf das Paradox der Theodizee in der Hoffnung, dass G’tt helfen kann und vielleicht doch helfen wird. So erzählt man vom Krebskranken, für den die Ärzte bereits keine Hoffnung mehr hatten, der aber doch geheilt wurde. Obwohl es solche Geschichten immer wieder gibt und wir das Wunder der Heilung dieser Menschen anerkennen dürfen und sollen, ist die Antwort unvollständig. Denn nach unserem besten Wissen hat noch nie ein Amputierter durch G’ttes Hilfe seine fehlenden Gliedmaßen wiedererlangt.
Aber was wäre das für eine Welt, wo es kein Leid gibt, wo alle Probleme mit einem Wunder verschwinden? Wäre das eine Welt, in der es menschliche Verantwortung, Nächstenliebe, sogar menschliche Vernunft geben könnte? Es wäre eine fabelhafte Welt, nicht aber eine Welt, in der eine Menschheit, wie wir sie kennen und wollen, existieren könnte.
Eine solche Welt entspräche eher dem statischen Jenseits, in das wir nach dem Ableben eintreten werden, nicht aber einer dynamischen Welt, in der menschliche Taten Bedeutung haben. Die Welt, in der wir leben und leben wollen, in der wir G’ttes Partner sein können und Seine Schöpfung miterbauen, die ist notwendigerweise auch eine Welt, in der es Leid, Not und Bedürfnis gibt.
Verantwortung Die natürliche Unheilbarkeit einer Amputation ist aber keine Mahnung gegen G’tt, sondern sie mahnt den Menschen. Was würde es bedeuten, wenn die Medizin in einigen Jahrzehnten Amputierte heilen könnte, und wir zudem herausfinden, dass wir es viel früher hätten schaffen können, aber diese Entdeckung wegen falsch gesetzter Prioritäten verzögert haben? Heißt das nicht, dass medizinischer Fortschritt unsere eigene Verantwortung ist?
Aber wo bleibt in diesem Weltbild dann G’tt? Wir stoßen auf ihn, wenn wir uns folgendem Midrasch zuwenden, in dem Awraham zu einer entscheidenden inneren Wende kommt. Auf einer Reise sieht er eine prächtige Burg – jedoch sie brennt. Da staunt Awraham und fragt: Wo ist der Herr der Burg? Ihm antwortet eine himmlische Stimme: «Ich bin der Herr der Burg» (Bereschit Rabba 39,1).
Die Erklärung Raschis ist: Nachdem Awraham sich wunderte, wieso die prächtige Welt, in der wir leben, ohne Schöpfer sein kann (denn alle prächtigen Gebäude haben einen Bauherren), wurde er zum Monotheisten – und G’tt offenbarte sich ihm. Jedoch befasst sich jene Erklärung nicht mit dem Brand, der im Midrasch erwähnt wird. Daher lehrt Rabbiner Esra Bick, dass Awraham nicht etwa Argumente lieferte, um an G’tt zu glauben, sondern sich mit der Frage der Theodizee auseinandersetzte. Awrahams Frage war nicht: «Kann es denn sein, dass es keinen G’tt gibt?», sondern er wunderte sich: «Wenn es G’tt gibt, und es gibt Ihn sicherlich, wieso erlaubt Er Leid in Seiner Welt?»
Aufgabe G’ttes Antwort ist zwar rätselhaft, aber eigentlich sagt Er: «Ich bin da, aber was tust du?» Das Feuer brennt, und Awraham dachte, es sei G’ttes Aufgabe, es zu löschen. G’tt aber weist ihn darauf hin, dass es vielmehr die Aufgabe Awrahams und die aller Menschen ist, uns vor G’tt unserer Verantwortung bewusst zu werden und sie zu übernehmen.
Ramban (Nachmanides) und in kürzerer Form auch der Raschbam lehren in ihren Kommentaren zum 2. Buch Mose (23, 20-22), dass G’tt bereits kurz nach dem Auszug aus Ägypten verkündete, dass Seine Präsenz nach dem Tod Mosches weniger spürbar sein wird. Dies kommt darin zum Ausdruck, dass Er «einen Boten senden wird», statt selber direkt in die Geschichte einzugreifen. Sogar die Einnahme des Landes Israel sollte fast «normal» geschehen: Jehoschua und das Volk Israel sollten militärische Mittel einsetzen.
Vielleicht ist der Grund für den Verzicht auf Wunder, dass es gar nicht so erstrebenswert ist, in einer bequemen Welt zu leben, in der alles übernatürlich ist. Rabbi Akiwa lehrt uns in der Mischna, dass «die Generation der Wüste keinen Anteil an der kommenden Welt» hat (Sanhedrin 10,3). Trotz aller Wunder hatten sie kaum Gottvertrauen.
Freiheit Vielleicht ist die Menschheit nicht dazu geschaffen worden, in einem Garten Eden voller Wunder zu leben. Vielleicht geht es uns viel besser in der schwierigen Welt, in der wir leben und in der wir die Freiheit haben, schreckliche Sünden und grausamste Verbrechen zu begehen – aber auch die Möglichkeit, das Edelste zu erreichen, zu dem der Mensch fähig ist.
Der Autor ist Mitglied des Beirats der Orthodoxen Rabbinerkonferenz. Der Text entstand dank einer Anregung von Joschka Kämmchen.