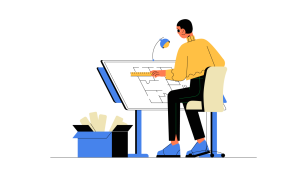Eine bekannte lateinische Redensart lautet »nomen est omen« – »der Name ist Zeichen«. Gemeint ist, dass der Name einer Person etwas über ihre Charaktereigenschaften verrät. Doch können wir tatsächlich aus dem Namen eines Menschen Schlüsse für den Umgang mit ihm ziehen? Aus einer talmudischen Geschichte (Joma 83b) geht hervor, dass drei Tannaiten über diese Frage nachgedacht haben.
Versteck »Einst befanden sich Rabbi Meir, Rabbi Jehuda und Rabbi Jose auf einer Reise. Rabbi Meir achtete auf den Namen, Rabbi Jehuda und Rabbi Jose hingegen nicht. Sie kamen in eine Ortschaft und suchten eine Unterkunft für die Nacht. Als sie ein Quartier erhielten, fragten sie den Wirt nach seinem Namen. Der Mann erwiderte: ›Kidor‹. Da dachte Rabbi Meir: Es scheint, dass der Wirt ein Bösewicht ist; denn es steht in der Tora: ›Ein Geschlecht (hebräisch: ki dor) von Falschheiten sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist‹ (5. Buch Mose 32,20). Rabbi Jehuda und Rabbi Jose übergaben Kidor ihren Geldbeutel; Rabbi Meir jedoch nicht. Er versteckte sein Geld im Grab von Kidors Vater.«
Erstaunlicherweise erriet der Wirt Rabbi Meirs Versteck. Denn es erschien ihm »im Traum (...) sein Vater, der zu ihm sprach: ›Komm, hol dir den Geldbeutel, der an der Kopfseite dieses Mannes liegt!‹ Als er den Tannaiten am Morgen seinen Traum erzählte, sagten sie zu ihm: Ein Traum in der Schabbatnacht hat keine Bedeutung!«
Raschi bemerkt zu dieser Passage, sie hätten Kidor nur davon abhalten wollen, zum Grab des Vaters zu gehen, um den Geldbeutel zu nehmen.
Geldbörse Doch zur Sicherheit begab sich Rabbi Meir zum Grab, verweilte dort bis Schabbatausgang und nahm dann seine Geldbörse wieder an sich.
»Am nächsten Tag sagten Rabbi Jehuda und Rabbi Jose zum Wirt: ›Gib uns bitte unsere Geldbeutel zurück.‹ Der Wirt erwiderte, er wisse nicht, wovon sie redeten.«
Kidor bestritt also dreist, ein Depositum erhalten zu haben. Er war offensichtlich ein gemeiner Dieb.
Rabbi Meir bemerkte zu dem Vorfall: »Weshalb habt ihr nicht auf seinen Namen geachtet?« Die beiden erwiderten: Weshalb hat uns der Meister dies nicht früher gesagt? Da antwortete er: ›Zwar dachte ich, es gäbe einen Grund zur Vorsicht, aber sicher war ich mir nicht.‹«
Sogar Rabbi Meir, der stets auf Namen achtete, hatte sich also nicht in der Lage gesehen, eine klare Warnung auszusprechen. Zwar hatte er Verdacht geschöpft und Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, mehr jedoch hatte er nicht unternommen.
Schnurrbart Mit dem Diebstahl wollten sich Rabbi Jehuda und Rabbi Jose nicht abfinden. Sie nahmen Kidor mit in eine Weinstube. Vielleicht hofften sie, der diebische Wirt würde sich im angetrunkenen Zustand verplappern – doch das geschah nicht. Im Weinlokal bemerkten die beiden einige Linsen an Kidors Schnurrbart. Diese Beobachtung nutzten sie aus.
Sie gingen zu seiner Ehefrau und sprachen zu ihr: »Dein Mann sagt, du sollst uns die Geldbeutel zurückgeben, und es soll als ein Zeichen gelten, dass ihr heute Linsen gegessen habt.« Da überreichte sie den Männern die Geldbeutel. Als der Wirt von der List der Bestohlenen erfuhr, wurde er wütend und erschlug seine Frau.
Bei der Lektüre unserer Geschichte drängt sich eine religionsgesetzliche Frage auf. In der Tora steht: »Halte dich fern von einem Wort der Lüge« (2. Buch Mose 23,7). Wieso belogen also Rabbi Jehuda und Rabbi Jose die Frau des Wirts?
Die Antwort ist eindeutig: Um Gestohlenes zurückzubekommen, darf man von der Wahrheit abweichen. Nach der Halacha gibt es in der Tat mehrere Fälle, in denen jemand die Unwahrheit sagen darf (Jewamot 65b und Baba Metzia 23b). So ist man zum Beispiel, um einen Mord zu verhindern, sogar verpflichtet zu lügen.
Wahrheit ist zweifellos ein wichtiger Wert, nach rabbinischer Auffassung aber eben nicht der höchste.