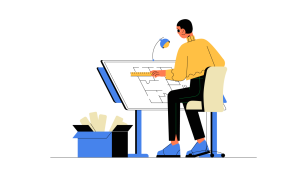Kollektives Gedenken hat seinen festen Platz im jüdischen Kalender, so beispielsweise an die biblische Sklaverei in Ägypten, das babylonische Exil oder die Zerstörung des Tempels durch die Römer. In der Tora werden die Israeliten dazu angehalten, sich ihrer Geschichte zu erinnern: »Gedenke, was dir Amalek getan« (5. Buch Mose 25,17). Pessach ist der zentrale Erinnerungstag nicht nur an den Auszug aus Ägypten, sondern auch an die grausamen Begebenheiten der Sklaverei: »Gedenkt dieses Tages, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Sklavenhaus, dass euch der Ewige von hier herausführt.«
Auch individuelles Gedenken hat mit der Jahrzeit oder Jiskor fest verankerte Punkte in unserem Leben. Aber wie gehen wir Juden mit den im Verlauf der jüdischen Geschichte hinzugekommenen Katastrophen um? Das Jüdische Museum Berlin zeigt gerade seine erste große Judaica-Ausstellung unter dem Titel »Alles hat seine Zeit. Rituale gegen das Vergessen«. Hier werden anhand von Objekten diverse Versuche nebeneinandergestellt, mit diesem hoch aufgeladenen Thema umzugehen, die zuweilen unterschiedlicher nicht sein könnten – von Kunstwerken des 21. Jahrhunderts bis zu jahrhundertealten Preziosen.
Identitätssuche Die gegenwärtige Situation zahlreicher jüdischer Menschen ist durch intensive Identitätssuche gekennzeichnet, die gelegentlich auch als Krise bezeichnet wird. Was diese Identitätssuche besonders dringlich macht, ist der Agnostizismus westlicher Gesellschaften. Einmal ganz abgesehen von der Schwierigkeit einer jüdischen Theologie nach Auschwitz, ist die Religion nicht sehr weit oben in der Skala der Glaubens- und Handlungsgrundsätze unserer Zeitgenossen angesiedelt.
Wie aber ist man mit der Erinnerung an die Opfer der NS-Herrschaft umgegangen? Der erste Gedenkgottesdienst für die Novemberpogrome von 1938 fand am 9. November 1939 in der Synagoge Heidereutergasse in Berlin-Mitte statt. Das Gebäude war bereits vor der sogenannten Reichskristallnacht im Besitz der Deutschen Post, die in dem barocken Bau ihr Hauptpostamt einrichten wollte und es verstand, ihn vor Zerstörungen durch die Schlägertrupps der SA zu schützen. Bis zur Umgestaltung war das Haus von der Post an die Jüdische Gemeinde zu Berlin vermietet worden. In diesem ersten uns bekannten Gedenkgottesdienst erinnerten Gemeindemitglieder namentlich an die am 9. November ermordeten Menschen und kollektiv an die zerstörten Synagogen.
Nach der Befreiung im April 1946 errichteten befreite Juden auf dem Gelände des wegen Seuchengefahr 1945 niedergebrannten KZs Bergen-Belsen einen Gedenkstein, der einem Grabstein ähnelte. In den in Deutschland wieder in Betrieb genommenen Synagogen wurden von Gemeinden Erinnerungstafeln angebracht, die die millionenfachen Opfer kollektiv beklagen, während einzelne Überlebende oder Rückkehrer auf den Gräbern von Familienangehörigen kleine zusätzliche Gedenksteine anbrachten, um der in den Vernichtungslagern oder anderenorts Ermordeten und nicht individuell Bestatteten zu gedenken. In Berlin wurden auch auf jüdischen Friedhöfen entsprechende Orte eingerichtet, an denen Überlebende ihrer Angehörigen gedachten.
verfolger Keiner wäre auf die Idee gekommen, dies mit einer Fotodokumentation der Verfolger zu ergänzen, schließlich waren allen die Schrecken der Nazizeit noch sehr deutlich vor Augen. Das sogenannte Dritte Reich war zwar vorüber, aber für die Zeitgenossen noch nicht Geschichte. In Jerusalem entstand auf dem Zionsberg neben dem Grab König Davids eine Gedenkstätte, in der auf Grabplatten ähnelnden Tafeln ausgelöschter Gemeinden gedacht wurde. Die Pinkas-Synagoge in Prag beispielsweise, die unmittelbar neben dem alten jüdischen Friedhof steht, wurde mit den Namen aller 77.000 ermordeten Juden Böhmens und Mährens versehen.
Mehr und mehr traten im Lauf der Zeit staatliche Institutionen, oft von Bürgerinitiativen oder Opferverbänden mit sanfter Gewalt veranlasst, auf und errichteten große Denkmalsanlagen: Yad Vashem in Israel, das Holocaust Memorial Museum in Washington oder das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. In Yad Vashem gehörte eine große eindrucksvolle Halle für Gedenkfeiern mit einem ewigen Feuer von Anfang an dazu, auch in Washington – beim Berliner Denkmal hingegen findet sich bis heute nicht einmal eine entsprechende Widmung.
Heute ist auch für nach der Schoa geborene Juden das Gedenken verbunden mit dem Lesen von Texten oder Bildern zur Geschichte der Schoa, denn nur noch wenige Zeitzeugen geben ein Bild der traurigen Erlebnisse. »Secher Liziat Mizrajim« (Zum Gedenken an den Auszug aus Ägypten) ist eine Standardformel jüdischer Gottesdienste eben nicht nur an Pessach, sondern zum Beispiel auch im Kiddusch, dem Weinsegnungsgebet. Das Verb »sachor« (erinnern) in all seinen Formen kommt in der hebräischen Bibel nicht weniger als 169-mal vor. Wer kennt nicht jene endlos langen Namenslisten, die an bestimmte Geschlechter erinnern (vgl. beispielsweise 1. Buch Mose 10, 1–32)?
wesen Das Judentum hat ein besonderes Geschichtsbewusstsein: »Wenn Gott sich am Sinai dem ganzen Volk zu erkennen gibt, ist nicht von seinem Wesen oder seinen Eigenschaften die Rede, sondern es heißt: Ich bin dein Gott, der dich führte aus dem Lande Ägypten, aus dem Haus der Dienstbarkeit.« In diesem Sinne ist jeder Jude, der sich – in welcher Form auch immer – zum Judentum bekennt oder bekennen könnte, ob religiös oder nicht, ein lebendiger Gottesbeweis.
Die Erinnerung an die Toten ist ein besonderes Kapitel jüdischer Tradition. Hat nicht Moses vor dem Exodus die Gebeine Josefs ausgegraben, um sie der Befreiung zu opfern? Werden nicht, wann immer ein Grab besucht wird, die Steine wiederaufgeschichtet, um es vor dem Vergehen zu bewahren, was sich im symbolischen Auflegen von Kieselsteinen auf jüdischen Grabsteinen durch die Zeiten erhalten hat?
Zu den Wallfahrtsfesten werden Haskarat Neschamot genannte Seelengedächtnisfeiern veranstaltet, um der Hingeschiedenen namentlich zu gedenken, ein Brauch, der seit den Hasmonäerkriegen im Jahr 165 v.d.Z. üblich ist (2. Makkabäer 22, 39–45). Seit dem 17. Jahrhundert sind sogenannte Memorbücher überliefert, in die jüdische Gemeinden insbesondere diejenigen eintrugen, die durch Kiddusch Ha-Schem, die sogenannte Heiligung Seines Namens, die Bereitschaft zum Selbstopfer unter Beweis stellten.
Es wird Zeit, dass sich alle Rabbiner Deutschlands über die Grenzen von Rabbinerkonferenzen hinweg zusammensetzen, um ein »Seder secher la-schoa« und eine gemeinsame Grundliturgie für dieses Erinnern an diejenigen festzuschreiben, die al Kiddusch Ha-Schem in ihre Welt gegangen sind.
Der Autor ist Rabbiner der Berliner Synagogengemeinde Sukkat Schalom und geschäftsführender Direktor der Stiftung Topographie des Terrors.