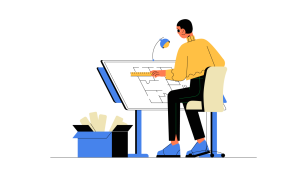Zwei wesentliche Themen beinhaltet unser Wochenabschnitt. Im ersten Teil lernen wir etwas über die Lebensführung der Kohanim, der Priester des Heiligtums. Insbesondere zur Zeit des Zweiten Tempels übernahmen sie verschiedene gesellschaftliche und kultische Aufgaben. Häufig waren sie Lehrer, Ärzte und sogar Richter in einer Person.
Auch daher achteten sie auf die seelische und körperliche Reinheit ihrer Person. Dies scheint der Prophetenvers zu unterstreichen: »Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Munde, und ward kein Böses in seinen Lippen gefunden … Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde das Gesetz suche; denn er ist ein Bote des Herrn« (Maleachi 2, 6–7).
Die zweite Hälfte der Parascha befasst sich mit den Festen unseres Volkes: Die drei Wallfahrtsfeste Pessach, Schawuot und Sukkot haben landwirtschaftliche und historische Hintergründe. Rosch Haschana und Jom Kippur dagegen sind nicht mit dem Heiligen Land verbunden. Diese Festtage sind der Reue und Umkehr des Einzelnen wie auch des ganzen Volkes gewidmet.
Die sieben Wochen zwischen unserem Befreiungsfest Pessach und dem Gesetzgebungsfest Schawuot werden Omerzeit genannt. Dieser Begriff weist auf ein Gebot der Tora hin, das dem jüdischen Landwirt im Heiligen Land – mangels Kalender – befahl, die Tage und Wochen zu zählen, damit er während der wichtigsten Wochen des Jahres, wenn das Getreide eingefahren wird, nicht vergisst, die dem Heiligtum und seinen Kohanim gebührenden Zehntel-Abgaben zu leisten.
Tempeldienst Heute besitzen wir kein Heiligtum mehr, und Kohanim im aktiven Tempeldienst gehören der Vergangenheit an. Dennoch gilt das Gebot der Tora, was die Zählung der Tage und Wochen zwischen Pessach und Schawuot betrifft, als unaufhebbar.
Die vergangenen Jahrhunderte unserer Volksgeschichte füllten gerade diese sieben Wochen des Öfteren mit denkwürdigen, traurigen Ereignissen. So fand im zweiten Jahrhundert nach der bürgerlichen Zeitrechnung der letzte große Aufstand gegen die römische Unterdrückung unseres Volkes in Israel statt. Der Name des Anführers in diesem Kampf ist uns überliefert: Schimon Bar Kochba, der »Sternensohn«.
Der Name birgt einen Hinweis auf einen Vers der Tora, in dem der Herr Israel einen »Stern aus Jakow« verkündete (4. Buch Mose 24,17). Viele sahen in Bar Kochba den verheißenen Messias. Die entscheidende Phase seines Kampfes gegen die damalige Weltmacht Rom, so vermutet man, fiel ebenfalls zwischen Pessach und Schawuot.
Pfeil und Bogen Der 33. Tag innerhalb der sieben Wochen wird von der volkstümlichen Überlieferung mit einem Sieg über die römischen Legionen verbunden. Daher ziehen Jugendliche an diesem Tag mit Pfeil und Bogen hinaus, veranstalten Sportwettkämpfe oder machen Ausflüge in die Natur. Für viele von uns gilt Bar Kochba als Symbolfigur für den Freiheitskampf gegen die Römer.
Er führte einen Kampf gegen die antijüdischen Bestimmungen des Kaisers Hadrian. Dieser hatte unter anderem das Studium der Tora, das Halten des Schabbats und die Beschneidung der Knaben verboten. Es blieb aber nur bei diesem einzigen Sieg, denn letzten Endes unterlag die kleine Schar der jüdischen Kämpfer der römischen Weltmacht.
Unter den modernen Forschern sind auch einige, die Bar Kochba als ein Beispiel für falschen Messianismus bezeichnen. Sie betonen, dass sein Auftreten dem jüdischen Volk eine Katastrophe und dem jüdischen Land die Zerstörung gebracht hat. Diese Wertung mancher moderner Historiker richtet sich eindeutig gegen den großen Gelehrten des nachbiblischen Judentums, Rabbi Akiba, der gemäß dem Rambam (1138–1204) »der Waffenträger des ›Königs‹ Bar Kochba« war.
Akiba war derjenige, der Bar Kochba zum Messias, dem Erlöser des jüdischen Volkes, erklärt hatte. Nach der Niederschlagung des Aufstands musste er dafür büßen. Die Römer folterten und verbrannten ihn schließlich auf dem Scheiterhaufen – vor den Augen seiner Schüler, die ihn nicht verleugnet hatten und auch nicht davongelaufen waren.
Im Übrigen gab es auch im Altertum Rabbinen, die Rabbi Akibas Ansicht zu Bar Kochba nicht teilten. So überliefert uns der Jerusalemer Talmud, dass Rabbi Jochanan ben Torta sagte: Akiba, es wird bereits Gras auf deinem Kinn wachsen, und der Sohn Davids, der wahre Messias, wird immer noch nicht eingetroffen sein (Taanit 4; 5; 68d).
Die Tage und die Wochen zwischen Pessach und Schawuot markieren den ferngebliebenen Erlöser. Auch daher sind sie eine traurige Zeit für uns.
Heiligung Aus unserer Parascha ragt folgender Vers heraus: »Schändet Meinen Heiligen Namen nicht, auf dass Ich inmitten der Kinder Israels geheiligt werde; Ich bin der Herr, der euch heiligt« (3. Buch Mose 22, 31–33).
Die maßgeblichen Denker des Judentums betrachten diesen Vers und seine Auslegungen als Eckpfeiler der jüdischen Ethik: Im Wesentlichen lässt sich feststellen, dass alles, was für uns Juden in unserem Leben erstrebens- und lobenswert ist, als »Kiddusch Haschem«, als Heiligung des Namens G’ttes, bezeichnet werden kann. Und all das, wovor man sich sehr, sehr hüten sollte, ist ein Verhalten, das im jüdischen Recht »Chillul Haschem«, »die Entweihung des Namens G’ttes«, genannt wird.
Unserer Auffassung nach ist die Lebensführung eines Juden einzig und allein seine individuelle, persönliche Angelegenheit, solange sein Tun und Lassen anderen keinen Schaden zufügt. Wie jemand sein Leben einrichtet, was er von den Grundregeln seines Judeseins wahrnimmt oder leugnet, muss er mit seinem Schöpfer zu gegebener Zeit »regeln«.
Völlig anders bewertet die Tora jedoch das Verhalten eines Juden, wenn er in der Öffentlichkeit durch sein Fehlverhalten elementare Rechte und Interessen anderer schädigt oder missachtet.
Derartige Handlungen könnten nämlich die ganze jüdische Gemeinschaft kompromittieren und ihr beträchtliche Schäden zufügen. Die Schrift betrachtet solche Handlungen als Blasphemie, als G’tteslästerung. Für derlei Verfehlungen Einzelner musste in der Geschichte sehr oft die Gesamtheit der Juden büßen.