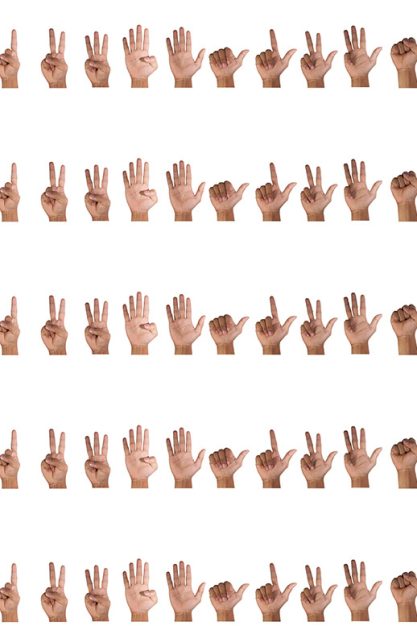Die Zeit des Omerzählens hat ihren Namen von einem speziellen Getreideopfer, das in der Zeit des Tempels in Jerusalem dargebracht wurde. Omer ist eigentlich eine Maßeinheit (so wie heutzutage das Kilogramm), die aber letztlich dem Opfer den Namen gab. Geopfert wurde Gerste, die als erstes Getreide nach dem Winter geerntet werden konnte. Es heißt dazu in der Tora (3. Buch Mose 23,10): »Sprich zum Volk Israel und sage ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das Ich euch gebe, und seine Ernte schneidet, so bringt ihr das Erstlingsomer eures Schnittes zum Priester.«
Dieser Vers macht auf zwei Dinge aufmerksam. Erstens geht es schon um ein Gebot für das Land Israel, das heißt, direkt nach der Befreiung aus Ägypten wird dem jüdischen Volk das eigentliche Ziel vor Augen geführt: Israel. Zweitens sollen wir bei allem Einkommen und Wohlstand, den wir uns erarbeiten, nicht vergessen, dass alles, was wir haben, letztendlich von G’tt kommt, und Ihm auch entsprechend dafür danken.
Symbol Rabbiner Samson Raphael Hirsch, der berühmte Begründer der modernen Orthodoxie (19. Jahrhundert, Frankfurt am Main) führt diese Gedanken noch etwas weiter. Das Omeropfer zur Ernte symbolisiert nämlich auch, dass wir nun nicht mehr nur einfach Freiheit haben, sondern auch über Besitz verfügen, nämlich das Land Israel. Das Opfer bezeugt also unsere Freude über die nationale Unabhängigkeit und das Eigentum, das wir nun – als ehemalige Sklaven – genießen.
Darüber hinaus erklärt Rabbiner Hirsch die Art des Opfers: Wie ein typisches Mincha-Opfer wird die Gerste nämlich nicht in Form von Ähren, sondern als Mehlopfer, also zusammen mit Öl und Weihrauch, dargebracht. Zusätzlich wird das Omer gewendet. Rabbiner Hirsch schreibt: »Durch die Handlungen des Wendens wird das im Omer repräsentierte materielle Nahrungsmoment (Mehl), der Wohlstand (Öl) und die sinnliche Befriedigung (Weihrauch) allen selbstischen und allen bloß irdischen Charakters entkleidet und in den Dienst der Gesamtheit und G’ttes gestellt.«
Spiritualität Durch das Omer lernen wir demnach, dass nicht das materielle Eigeninteresse zählt, sondern dass unser Wohlstand nur Mittel zum Zweck ist. Wichtiger sind die Gemeinschaft und das Spirituelle, die Suche nach G’tt. Das Opfer zum Omer gibt es seit der Zerstörung des Tempels nicht mehr, aber wir zählen immer noch die Omertage, die zwischen Pessach und Schawuot liegen und die beiden Feiertage verbinden (2. Buch Mose 23, 15–16).
Der Rambam erklärt (in More Nevuchim 3,43): »Schawuot ist die Zeit des Gebens der Tora. Um diesen Tag zu ehren und zu erheben, zählen wir die Tage vom vorherigen Fest (Pessach) bis Schawuot, so wie jemand, der darauf wartet, dass ein geliebter Mensch ankommet und die Stunden der Tage des Wartens zählt. Das ist der Grund, warum wir Omer zählen ab dem Tag, als wir Ägypten verlassen haben, bis zum Tag des Gebens der Tora – dem ultimativen Ziel des Auszugs aus Ägypten: ›Und Ich werde sie zu Mir bringen‹ (2. Buch Mose 19,4).«
So hebt die Mizwa des Omerzählens die Bedeutung der Tora hervor, die wir an Schawuot erhalten. Das Zählen zeigt und erinnert uns an die Bedeutung der Tora für uns als Ziel und Teil der Freiheit.
Doch der Midrasch (Tanchuma Yashan, Jitro 9) warnt: Eigentlich wollte G’tt dem jüdischen Volk die Tora gleich nach dem Auszug aus Ägypten geben, aber die Streitigkeiten innerhalb des Volkes und der Wunsch, nach Ägypten zurückzukehren, haben G’tt warten lassen, denn »G’tt sagte: ›Die ganze Tora ist Frieden. Wem soll Ich sie geben? Einem Volk, das den Frieden liebt.‹ Das ist die Bedeutung des Endes des Verses ›Und alle ihre Pfade sind Frieden‹« (Mischlei/Sprüche 3,17).
Konflikte und Streitigkeiten verzögerten die Übergabe der Tora. Das passt zum veränderten Charakter des Omer heute. Seit der Zeit von Rabbi Akiwa (im 2. Jahrhundert) sind die Omertage zu einer Trauerzeit geworden, an der wir keine Hochzeiten feiern, keine Musikkonzerte besuchen et cetera.
Der Talmud (Traktat Jewamot 62b) erklärt den Grund dafür: »Rabbi Akiwa hatte 12.000 Schülerpaare von Givat bis Antiprat, und sie alle starben während dieser einen Periode, weil sie sich nicht gegenseitig respektierten. Die Welt war am Abgrund, bis Rabbi Akiwa zu den Rabbinern des Südens kam und sie unterrichtete; Rabbi Meir, Rabbi Jehuda, Rabbi Jossi, Rabbi Schimon und Rabbi Elasar ben Schamua. Sie waren es, die die Tora zu dieser Zeit wiederherstellten!«
Respekt Im Talmud heißt es ausdrücklich nicht »24.000 Schüler«, sondern »12.000 Paare«. Das zeigt die Zerrissenheit dieser Schüler. Sie waren zwar große Toragelehrte, aber egoistisch und ohne Respekt füreinander. Die Tora kann aber nicht von Individualisten weitergegeben werden, die nur ihre eigene Meinung für richtig halten. Was diese vielen Schüler nicht schaffen konnten, erreichte schließlich die kleine Gruppe von fünf. Sie waren füreinander da, sie haben die Meinung des anderen respektiert und Ideen ausgetauscht. Nur so kann die Tora von Generation zu Generation weitergegeben werden.
Genauso ist es auch mit einer jüdischen Gemeinde. Nur wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und uns gegenseitig respektieren, werden wir alle zusammen Erfolg haben. Dabei ist es wichtig, die Meinung des anderen zu akzeptieren. Die Tora – und speziell die mündliche Lehre – hat nur durch Pluralismus eine Zukunft.
Der Autor war Rabbiner in Düsseldorf. Zurzeit arbeitet er als Research Fellow an einem Forschungsprojekt des Schweizerischen Nationalfonds.