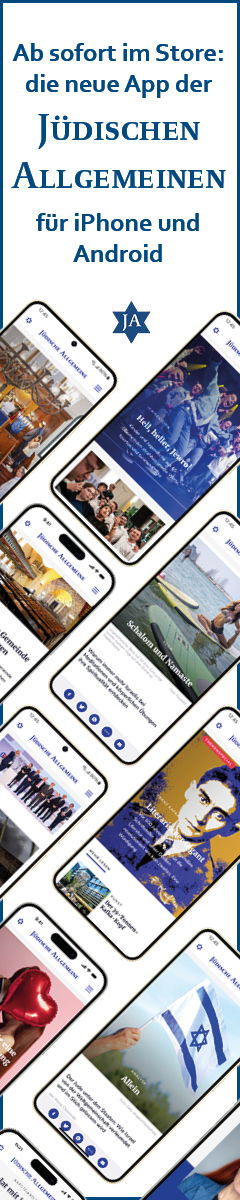EDITORIAL Terror-Verherrlichung, antisemitische Schlachtrufe, das Feiern des Massakers an 1400 Israelis, Molotowcocktails auf eine Synagoge, Davidsterne an Häusern von jüdischen Familien, Aufrufe zur Gewalt gegen Juden: Die vergangenen drei Wochen haben bei der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland tiefe Spuren hinterlassen. Als die »Jüdische Allgemeine« in diesen Tagen Juden und Jüdinnen gefragt hat, ob sie beschreiben wollen, wie sie die zahlreichen antisemitischen Ausschreitungen von arabischstämmigen Deutschen und Migranten erlebt haben, reihte sich Absage an Absage. Der Grund: Angst. »Wir fürchten uns«, hieß es oft. Oder: »Wir würden gern, aber es ist zu gefährlich.« Manchmal auch: »Auf gar keinen Fall mit Foto und Klarnamen.« Hier möchten wir denen, die sich trauen, Gehör verschaffen.
Lea Streisand (44), Berlin
Ich habe mich seit dem 7. Oktober kaum aus dem Haus getraut. Nicht, weil ich Angst um meine Person hatte, ich hatte schlicht keine Kraft für »Ja, aber«-Diskussionen. Seit 15 Jahren mache ich Therapie gegen mein Transgenerationstrauma, und nun sitzen junge Linke vor dem Auswärtigen Amt in Berlin und skandieren »Free Palestine from German guilt«. Ich habe nur noch geheult. Ich dachte, »Nie wieder Auschwitz« wäre der Ursprung der deutschen Antifa, aber es war wohl doch nur »Hitler hatte nen hässlichen Bart«. Bei der Demo am Brandenburger Tor in Berlin vergangenen Sonntag war ich so dankbar, ich hätte am liebsten jedem Einzelnen der mehr als 10.000 Teilnehmenden die Hand geschüttelt.
Michael Movchin (26), München
Ich erhalte derzeit sehr viele Hasskommentare auf Social Media. Aber ich werde weiter jüdische Veranstaltungen und die Synagoge besuchen. Beim vergangenen Gottesdienst galt die meistgestellte Frage der Sicherheit. Neu ist, dass Orte in München im Netz geteilt werden, wo es gefährlich werden könnte und die man lieber meiden sollte. Es ist bitter, dass so etwas nötig ist. Ich bin nun vorsichtiger. In Cafés oder in der Bahn mag ich nicht mehr telefonieren, wenn es um Israel oder jüdische Themen geht. Denn ich weiß nicht, wer neben mir sitzt. Diese Gespräche führe ich nur noch von sicheren Orten aus.
Rabbinerin Yael Deusel (63), Bamberg
Meine Praxis liegt an einer sehr belebten Straße, und das Praxisschild wird von dem Licht einer Apotheke angestrahlt. Dennoch schaffte es jemand, ein Hakenkreuz hineinzukratzen. Die Absicht ist eindeutig. Da muss sich jemand wirklich Mühe gegeben haben, denn so etwas kritzelt man ja nicht rasch dahin. Mich hat das sehr betroffen gemacht. Um meine Sicherheit mache ich mir nicht so viele Sorgen wie um die meiner Mitarbeiter, der Patienten und der Gemeindemitglieder. Was mich in dieser schweren Zeit sehr erfreut, ist, dass es hier sehr viele Solidaritätsbekundungen gibt.
Noam Petri (20), Berlin
Hassnachrichten in den sozialen Medien bin ich gewohnt. Wie gehe ich damit um? Meistens mit Humor. Vor wenigen Tagen ist mir das Lachen jedoch vergangen. Ich bin Stipendiat bei der Gerhard C. Starck Stiftung. In meiner Universität bewirbt eine Studentengruppe ihr Event mit ihrem Kooperationspartner Islamic Relief Deutschland. Der Islamic Relief Deutschland ist nach eigenen Aussagen »eine gemeinnützige deutsche Nichtregierungsorganisation mit humanitärem Auftrag«. Laut dem israelischen Verteidigungsministerium sind sie »Teil des Finanzsystems der Hamas«. Nach Kenntnissen der Bundesregierung verfügt diese NGO über »signifikante personelle Verbindungen zur Muslimbruderschaft«. Der ehemalige Vorsitzende Almoutaz Tayara bezeichnete Hamas-Terroristen als »großartige Männer«. Diese Studenten sind die Ärzte von morgen. Das sollte jeden Demokraten verunsichern.
Sarah Serebrinski (45), Berlin
Generell bin ich ziemlich angstfrei und mutig. Mein Credo war immer: Wir sollten unser Jüdischsein stolz und ohne jegliche Einschränkung leben und auch zeigen. Mittlerweile bin auch ich besorgt um meine Kinder, die auf jüdische Schulen gehen, um Familie und Freunde, die ihre Mesusa abnehmen, die sich nicht trauen, in die Synagoge oder zu jüdischen Veranstaltungen zu gehen. Aber auch um unsere Gesellschaft als Ganzes, die nun eine Möglichkeit gefunden hat, ihren subtilen Judenhass in Form von Anti-Israel-Hass überall zum Ausdruck zu bringen. Ich bin sehr besorgt, dass etwas in der Luft hängt, was es in den vergangenen Jahrzehnten so nicht gab – ein generelles Unwohlsein innerhalb der jüdischen Community. Zugleich bereitet es Zuversicht, wenn auch so viel Solidarität kommt. Irgendwann wird alles wieder gut; gut in dem Sinne, dass wir es wieder »nur« mit den üblichen Antisemiten zu tun haben und dass wir uns nicht mehr tagtäglich um unsere Familien und Freunde in Israel Sorgen machen müssen.
Robert Urseanu (47), Frankfurt am Main
Mit einem Freund habe ich kürzlich nachts Plakate an Litfaßsäulen geklebt: »Lasst die Geiseln frei!« Auf dem Rückweg haben wir gesehen, dass viele Plakate schon wieder abgerissen worden waren. Welche Werte vertritt jemand, der Plakate von entführten Babys, Müttern und Greisen von Litfaßsäulen entfernt? Heißt das im Umkehrschluss, er befürwortet diese grässlichen Taten? Ich ärgere mich über diese schreckliche Entwicklung gerade auch in Deutschland. Es reicht mir! Ich bin Frankfurter, Deutscher, Jude. Ich möchte und werde mich nicht verstecken. Wenn wir anfangen, uns zu verstecken, dann ist das eine Kapitulation.
Rabbiner Yitzchak Mendel Wagner (44), Krefeld
Meine Familie und ich sind nicht ängstlich. Wir fühlen uns sicher. Mit Kippa und Hut werde ich rasch erkannt. Jüngst sprach mich ein Muslim an und sagte mir leise, dass Israel es richtig mache, sich zu wehren. Überhaupt erlebe ich viel Solidarität. Meine Kinder gehen ganz normal in die Schule und zur Kita. Wir werden unser gewohntes Leben weiterführen und Israel unterstützen, wo immer es uns möglich ist. Wir appellieren an alle, die Israel helfen wollen, uns zu kontaktieren. So kommen wir ins Gespräch und geben dann Tipps.
Deborah Feinstein (25), Berlin
Immer wenn der Nahost-Konflikt eskaliert, spüre ich das in Berlin, aber noch nie so heftig wie jetzt. Ein paar Tage nach den Massakern habe ich auf der Straße ein Graffiti gesehen, in dem auf Hebräisch »Tod für Israel!« stand, und dazu war ein Asmodäus gemalt. Das hat mir wahnsinnige Angst eingejagt, weil das jemand mit Hintergrundwissen gesprüht haben muss. Auch deswegen bin ich in den vergangenen Tagen öfter zu Hause geblieben, und wenn ich vor die Tür gehe, dann ohne meinen Magen David. Ich lese in der Öffentlichkeit keine hebräischsprachigen Medien mehr und telefoniere nicht mehr mit Freunden in Israel. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Wir haben Angst. (Name aus Sicherheitsgründen geändert)
Mark Krasnov (35), Wiesbaden
Die Situation ist bedrückend. Ich bin sehr besorgt, was uns hier noch erwartet in Deutschland. Der Angriff auf die Gemeinde in Berlin letzte Woche – das ist etwas, was wir nicht erwartet haben. Jetzt kann man gar nicht mehr so sicher sein, jetzt ist es gar nicht mehr so weit weg. Auch hier in Wiesbaden ist es irgendwie da. Ja, was ist dieses »Es«? Dieses Es ist eine Gewalt, die es in dieser Form so bisher nicht gegeben hat. D ass jetzt wieder Wohnungen von Juden mit Davidsternen an den Türen gekennzeichnet werden – es graust einen. Diese Bilder kennen wir aus den zwölf dunkelsten Jahren der Geschichte dieses Landes. Und wir haben uns bisher so in Sicherheit gewähnt hier in Deutschland.
Max Breslauer (38), Süddeutschland
Klingelt es an der Haustür, schrecke ich hoch. Alle Nachbarn in dieser Kleinstadt wissen um mein Jüdischsein. Einige haben aufgehört, mich zu grüßen. Das Schweigen meiner nichtjüdischen Freunde: ohrenbetäubend. Mit jüdischen Vertrauten diskutiere ich mögliche Emigrationsziele. Doch: wohin nur? Egal, ob in Berlin oder Frankfurt, London oder Kapstadt, New York oder Sydney – zu Hunderttausenden strömen Judenhasser auf die Straßen und drohen uns mit dem Tod. Die Polizei überfordert, der Staat guten Willens, aber hilflos. Ich muss an ein unschuldiges Spiel aus Kindertagen denken: »Ich packe meinen Koffer und nehme mit.« Ein kindlicher Zeitvertreib, der für uns Juden über Nacht zur bitter-ernsten Realität geworden ist. (Name aus Sicherheitsgründen geändert)
Herbert Rubinstein (87), Düsseldorf
Es kommt so viel an Fakten und laufenden Informationen zusammen, dass ich als 87-jähriger Schoa-Überlebender, der die damalige Zeit durchlitten und nur durch viele glückliche Umstände überlebt hat, sage: Es droht noch schlimmer zu werden als damals. Für die freie Welt und somit für uns alle. Die Unsicherheit ist zermürbend. Ich bete, und ein kleiner Trost ist vielleicht die Prophezeiung, wonach im jüdischen Jahr 6000 der Maschiach und damit der weltweite Frieden kommen wird. Aber das mindert nicht meinen Schmerz um die Familienmitglieder in Israel und um die vielen Kinder, jungen Menschen und Erwachsenen, die ermordet wurden, und um die Hinterbliebenen, um die wir alle trauern. Die se Trauer macht mich wütend, aber sie macht mich auch stark, sodass ich sage: Wir werden das überleben. Wir stehen fest zusammen und werden in der Gemeinde dafür sorgen, dass unsere Mitglieder, ohne Angst zu haben, weiter am Gemeindeleben teilnehmen, die Gottesdienste regelmäßig besuchen und dass jüdisches Leben diese schweren Zeiten überleben wird. Israel wird leben!
Mirjam Alba, Frankfurt
Nach den Attacken in Israel befand ich mich zunächst in einer Art Schockstarre. Nach der Trauer kamen die Wut und die Enttäuschung. Auch gegenüber der deutschen Gesellschaft, die mich spüren ließ, dass der Antisemitismus stärker unter uns grassiert als gedacht. Ich frage mich nun nach all den Protesten und Drohungen hier in Deutschland immer wieder: War es das alles wert? Wo bleiben nach jahrelangem Engagement vonseiten der Politik, aber auch von privaten Initiativen, die sich mit aller Kraft gegen Antisemitismus eingesetzt haben, die Erfolge? Alle Begegnungen, alle konstruktiven Gespräche, all die Offenheit – alles für nichts? Waren wir als Jüdinnen und Juden so naiv zu denken, dass es keinen Antisemitismus mehr gibt? Das bereitet mir Sorge.
Irene Runge (80), Berlin
Angst? Ich, die jüdische Berlinerin, die wegen der Nazis 1942 in Manhattan zur Welt kam? So viel zu Deutschland. Angst, dieses bedrückende, allen Lebensmut blockierende Gefühl? Mitten in Berlin bin ich wie alle Zeugin des Hamas-Terrors gegen meinesgleichen in Israel. Doch Antisemitismus ist überall zu Hause. Ich begreife ihn nicht. Dieser November wird speziell: Es gab historische Pogrome, Revolutionen, jetzt lechzt die Hamas nach Israels Blut und Boden. Aber deshalb zu Hause bleiben? Nein. Wobei ich seit Langem höchst ungern nachts mit der U8 fahre … Noach begann im Alter von 480 in einem November, die Arche zu bauen, er zimmerte 120 Jahre, in der Zeit konnte viel nachgedacht werden, dann wurden Mensch, Tier und Pflanzen darin vor der Sintflut gerettet. Ein Gleichnis? Wir sollen wurzeln, bauen, bleiben, wiederkommen, nie wegschwimmen.
Melissa Vapner (20), Berlin
Vor zehn Tagen hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben entschieden, aus Angst meine Davidsternkette abzunehmen. Es fühlte sich an, als würde ich einen Teil meiner Identität ablegen. Nach einer Woche beschloss ich, dass ich mein Leben nicht einschränken will. Meine Kette trage ich wieder, und jüdische Einrichtungen besuche ich wie gewohnt. Es ist mir wichtig, der Angst entgegenzuwirken. Bis jetzt habe ich keine unangenehme Begegnung gehabt und von meinem nahen Umfeld sehr viel Solidarität und Verständnis erfahren. Vielen Menschen auf Social Media bin ich entfolgt, weil sie antisemitische Beiträge teilen oder den Terror der Hamas gar verherrlichen. Mit meinen Gedanken bin ich die ganze Zeit in Israel, doch gleichzeitig wird man mit einer neuen Lebensrealität in Deutschland konfrontiert. Ich wohne in Berlin. Zu wissen, dass in meiner Stadt Molotowcocktails auf eine Synagoge geworfen wurden und Hamas-Parolen auf den Straßen geschrien werden, verändert mein Sicherheitsgefühl - und zwar enorm.
(Zusammengestellt von Katrin Richter, Christine Schmitt, Marco Limberg, Tobias Kühn, Nils Kottmann, Nicole Dreyfus und Philipp Peyman Engel)