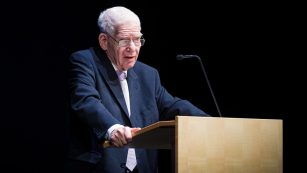Die derzeitige Debatte um die Frage nach einer gelingenden Integration der Flüchtlinge in unsere Gesellschaft erinnert ein wenig an die Auseinandersetzung um die »angemessene« Kindererziehung. Alle wissen, dass pädagogische Konzepte und Interventionen notwendig sind, aber welche Ansätze überzeugen und sich schließlich durchsetzen, ist in unserer pluralen Gesellschaft immer strittig. Die einen verlangen mehr, die anderen weniger disziplinarische Sanktionen, wenn sich die Kinder weigern, den Vorstellungen der Eltern oder den Spielregeln der Schule zu folgen.
Über den Integrationsbegriff ist ebenso wenig ein Konsens herstellbar. Dies hat im Wesentlichen mit dem Menschen- und Gesellschaftsbild zu tun, das diesem Begriff zugrunde liegt. Zunächst einmal lassen sich einige soziologische Perspektiven benennen, die für den Zusammenhalt einer Gesellschaft erforderlich sind: Hierbei handelt es sich nicht um ideologische, sondern um funktionale Teilbereiche dieses großen Begriffs »Integration«.
einbindung Unterschieden wird zwischen der sozialen, kulturellen, ökonomischen und rechtlichen Einbindung in eine Gesellschaft. Ziel dieses Prozesses ist die aktive Teilhabe der Individuen an den unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern, sodass sie motiviert werden, sich mit der Gemeinschaft und ihren zentralen Wertorientierungen zu identifizieren. Der hier beschriebene Verlauf gilt für alle Mitglieder der Gesellschaft, ganz gleich, ob sie einen Migrationshintergrund haben oder nicht.
Im Falle der Flüchtlinge stellt sich zunächst einmal die Frage, ob ein gesellschaftlicher Konsens darüber besteht, dass sie in Deutschland bleiben sollen. Unabhängig von dieser Einschätzung schreibt das Asylrecht vor, dass Personen aus Bürgerkriegsländern nicht in ihre Heimat abgeschoben werden dürfen, da ihnen dort Verfolgung oder gar der Tod drohen könnte.
Da damit zu rechnen ist, dass die Beendigung der nahöstlichen Bürgerkriege noch lange auf sich warten lässt und die überwiegend traumatisierten Flüchtlinge in absehbarer Zeit nicht mehr in ihre Herkunftsländer zurückkehren wollen und können, stellt sich die Frage nach einem intelligenten und zukunftsorientierten Umgang mit der Situation.
identifikation Deutschland hat es in den ersten Jahrzehnten der Zuwanderung nach dem Zweiten Weltkrieg versäumt, die Tatsache anzuerkennen, dass der Prozess der Immigration irreversibel ist. Erst 50 Jahre nach dem Beginn der Anwerbung von Arbeitsmigranten entschied sich die politische Mehrheit, die Realitäten juristisch zu sanktionieren. In all diesen Jahren migrationspolitischer Passivität gab es eine Ausnahme: Die Aufnahme der russischsprachigen jüdischen Zuwanderer wurde durch diverse Angebote unterfüttert, die eine Integration in und eine Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft ermöglichen sollten. Und dies wurde zu einer wahrhaften Erfolgsgeschichte.
Deutschland erhält nunmehr eine zweite Chance, sich bewusst auf die Eingliederung und Einbindung von Hunderttausenden von Menschen aus uns kaum vertrauten sozialen und kulturellen Kontexten einzulassen. Integration ist ein Angebot, das von Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund angenommen oder abgelehnt werden kann.
Wenn die aufnehmende Gesellschaft die notwendigen einladenden Schritte unternimmt, wird es nur wenige unter den Zuwanderern geben, die ein solches Angebot nicht wahrnehmen können oder wollen. Der gesellschaftliche Druck innerhalb der Flüchtlingscommunity wird so groß sein, dass eine selbst gewählte Ausgrenzung entsprechend geahndet wird. Wer sich dennoch für den Weg des abweichenden oder kriminellen Verhaltens entscheidet, wird selbstverständlich mit der Härte des Gesetzes bestraft. Auf diese berechenbare Reaktion unseres Justizapparates sollte natürlich Verlass im Rechtsstaat sein.
gleichberechtigung Das liberale Integrationskonzept impliziert ebenso wie das Grundgesetz, dass jeder Mensch das Recht hat, sich kulturell und religiös zu entfalten. Die Religionsfreiheit und die Gleichberechtigung der Geschlechter sind hehre und erkämpfte Werte in unserer Gesellschaft. Konflikte und Reibungen sind bei der Durchsetzung dieser Überzeugungen voraussehbar. Hier gilt es zu erklären, zu werben und engagiert für die eigenen Positionen zu streiten. Zugleich müssen wir aufmerksam sein, um Formen der Unterdrückung, die im Namen religiöser oder kultureller Traditionen praktiziert werden, rechtzeitig zu skandalisieren und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.
Integration beruht auf der Überzeugung, dass der Weg in die Gesellschaft sich lohnt. Wir können den vorbildhaften und Erfolg versprechenden Voraussetzungen unseres Gesellschaftssystems trauen und diesem zutrauen, die beschriebene Herausforderung zu meistern, ohne Zwang, aber mit klaren, transparenten Strukturen, die den Weg vom Rand in die Mitte der Gesellschaft eröffnen.
Der Autor ist Professor für Interkulturelle Erziehung in Erfurt und Wissenschaftlicher Direktor der Bildungsabteilung im Zentralrat.