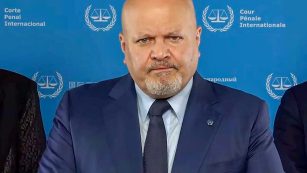Der Schatten des Zweiten Weltkriegs liegt weiterhin über den polnisch-deutsch-jüdischen Beziehungen. Warum es Polen und polnischen Juden so schwerfällt, die Tragödie des Krieges und der Schoa zu vergessen, liegt auf der Hand. Aber Krieg bringt leider Opfer auf beiden Seiten mit sich. Man mag die Frage stellen: Warum ihn dann erst beginnen? Interessierte Kreise in Deutschland heben zunehmend die Rolle des Übels hervor, das ihre Gesellschaft infolge des Krieges heimgesucht hat. Als Beispiele werden Dresdens Bombardierung 1945 und der Verlust der früheren »Ostgebiete« angeführt. Letzteres beklagt vor allem der Bund der Vertriebenen (BdV). Um dessen Präsidentin Erika Steinbach tobt seit Monaten eine heftige Debatte.
Es geht dabei um die mögliche Nominierung der CDU-Politikerin für den Rat der »Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung«. Das Gremium soll dabei mitwirken, »im Geist der Versöhnung auch in Berlin ein sichtbares Zeichen zu setzen, um an das Unrecht von Vertreibungen zu erinnern und Vertreibung für immer zu ächten«. Die Bundesregierung, allen voran Außenminister Guido Westerwelle, befürchtet nicht zu Unrecht, die Personalie könnte die Beziehungen zu Polen beschädigen. Vergangene Woche hat Steinbach vorgeschlagen (sie nennt das einen »Kompromiss«), auf einen Sitz im Stiftungsrat zu verzichten. Doch stellt sie Bedingungen, mit denen der Einfluss der Bundesregierung deutlich verringert und der des Bundes der Vertriebenen gestärkt werden soll.
Steinbachs Ideen schüren die polnischen Ängste vor den deutschen Nachbarn. Viele Polen – Juden und Nichtjuden – reagieren empört auf Versuche, die Leiden der Besatzer mit denen der Besetzten gleichzusetzen. Wer der BdV-Präsidentin aufmerksam zuhört, könnte meinen: Weil es bis heute an Verständigung mangelt, sind Polen und Deutschland auch im Jahr 2010 noch durch einen Graben getrennt.
Doch hier und da fangen zarte Pflänzchen an zu gedeihen: Die »Soziokulturelle Gesellschaft der Juden in Polen«, deren Mitglied ich bin, unterhält seit vielen Jahren Kontakte zu Einrichtungen in Deutschland. Und im vergangenen Sommer haben wir die Zusammenarbeit mit der deutschen Minderheit in Polen begonnen, mit dem »Verband der deutschen sozialkulturellen Gesellschaften in Polen«. Es geht uns um den Aufbau guter Verbindungen zwischen beiden nationalen Gruppen auf polnischem Boden. Doch manchmal, wenn Leute wie Erika Steinbach das Wort ergreifen, vergewissere ich mich in einem Gespräch mit Vertretern der deutschen Minderheit, dass unsere zarte Beziehung nicht in Gefahr ist.
Viele Juden, die sich vor dem Holocaust retteten, gelangten nach 1945 in die ehemals deutschen Gebiete und unterstützten deren Wiederaufbau aktiv. Bis heute bestehen Abteilungen unserer Organisation in Städten, die früher zu Deutschland gehörten. Niemand wird es Frau Steinbach verübeln, darüber traurig zu sein, dass diese Orte heute nicht mehr deutsch sind. Doch für eine BdV-Präsidentin muss sich jeglicher Anflug von Revisionismus verbieten. Steinbachs Versuche, die Geschichte zu relativieren, indem sie die deutschen Opfer der Vertreibung mit den polnischen Kriegsopfern auf eine Stufe stellt, rufen in Polen unnötige Abneigungen gegenüber Deutschen hervor.
Manche Polen sehen in Erika Steinbachs Trommelwirbeln vor allem ein persönliches Problem: Auf der Jagd nach Ruhm, den sie als Violinistin nicht erlangte, habe sie entschieden, ihre Familiengeschichte und einen eindeutig verlorenen, wahnsinnigen Krieg auszubeuten. Wenn sich ihre Träume einer Musikerkarriere erfüllt hätten, müssten wir Erika Steinbach nicht kennen. Gegenwärtig aber spielt sie erinnerungspolitisch in der Öffentlichkeit die erste Geige. Und es scheint sie nicht allzu sehr zu kümmern, dass sie dabei die Dämonen der Vergangenheit heraufbeschwört. Diejenigen Deutschen, die die Nachkriegsgeneration eine andere Denkweise lehrten und eine Nation schufen, die die Fehler ihrer unrühmlichen Vergangenheit nicht mehr begeht, verfolgen die Tätigkeit der BdV-Chefin mit Missbehagen. Allein der Gedanke daran, dass ihre Ideen Anhänger finden könnten, erfasst viele Polen mit Entsetzen.
Doch ruhig Blut! Die Causa Steinbach ist nur einer von vielen Aspekten der polnisch-deutschen Beziehungen. Es wäre falsch, die Verbindungen zwischen beiden Ländern in Gefahr zu sehen, nur weil eine Politikerin unverantwortliche, hoffentlich nicht repräsentative Aussagen macht. Dies gilt es zu beachten, wenn es um die Frage der Nominierung Steinbachs für den Rat der »Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung« geht.
Der Autor ist Redakteur der Kulturzeitschrift »Slowo Zydowskie« (Das Jüdische Wort) in Warschau.