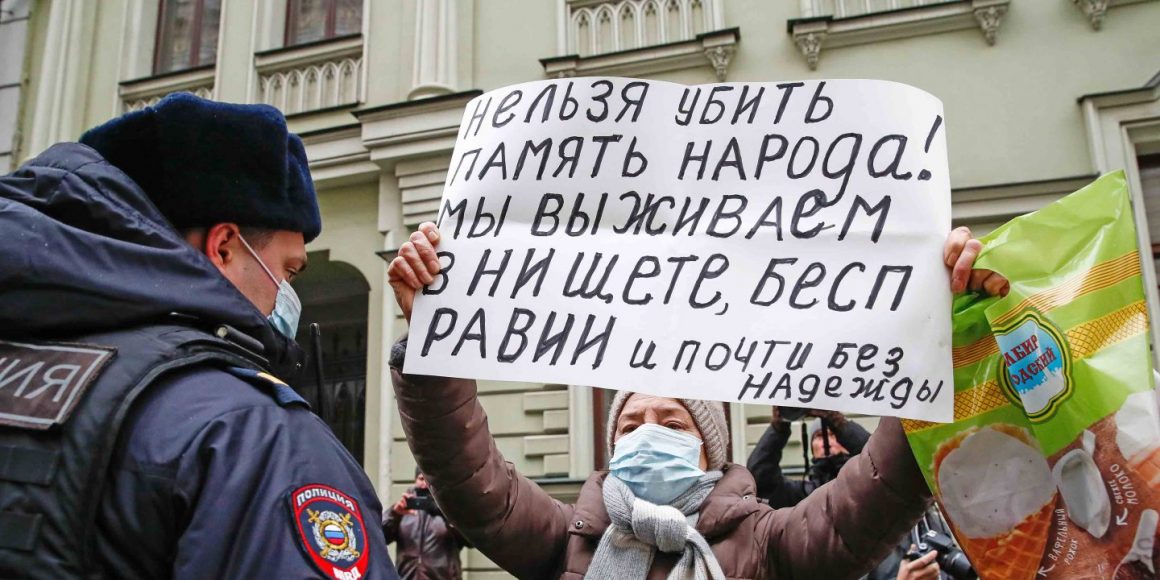Herr Wagner, zahlreiche deutsche KZ-Gedenkstätten haben sich mit der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial International solidarisiert. Ende Februar soll vor einem Gericht in Moskau über die Berufung von Memorial International gegen die Auflösung der Organisation verhandelt werden. War das der Anlass für die Solidaritätserklärung?
Ja, diesmal geht es um den absurden Vorwurf, dass Memorial angeblich die »Rehabilitation des Nazismus« betreibe. Zuvor hatte die Organisation der russischen Weltkriegsveteranen Memorial angezeigt, weil angeblich in ihrer Datenbank Neonazis gewürdigt würden. Wir haben aber bereits im Dezember 2021 protestiert, als ein russisches Gericht die Auflösung von Memorial verfügt hat. Wir arbeiten seit über 20 Jahren mit dieser Organisation sehr, sehr eng zusammen – nicht nur die Gedenkstätte Buchenwald, sondern auch andere Gedenkstätten. Schon bei der Vorbereitung unserer Ausstellung zur Geschichte des sowjetischen Speziallagers Buchenwald (1945–1950), die 1997 eröffnet wurde, gab es einen engen Kontakt. Vor etwa zehn Jahren haben wir eine Ausstellung über den Gulag erarbeitet, die maßgeblich auf den beeindruckenden Objekten und Unterlagen von Memorial beruht. Und Memorial hat uns auch bei unserer internationalen Wanderausstellung über die Geschichte der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus sehr geholfen, die wir 2011 in Moskau präsentiert haben.
Wie hat sich die Zusammenarbeit gestaltet?
Ich selbst war in Moskau im Archiv von Memorial und habe dort zahlreiche Unterlagen gesichtet, die in der Ausstellung zur NS-Zwangsarbeit verwendet wurden. Viele sowjetische Zwangsarbeiterinnen, aber auch sowjetische Gefangene in deutschen KZs standen nach dem Krieg in ihrer Heimat jahrzehntelang unter dem Generalverdacht der Kollaboration. Memorial hat in den 90er-Jahren maßgeblich dazu beigetragen, dass die ehemaligen Zwangsarbeiter von der postsowjetischen Gesellschaft angemessen gewürdigt wurden.
Wie haben Sie das Archiv in Moskau erlebt?
Das ist ein fach- und sachkundig inventarisiertes Archiv – genauer gesagt, eine Sammlung. Memorial verfügt über eine sehr große Zahl von dreidimensionalen Objekten aus dem Kontext Gulag, aber auch der NS-Zwangsarbeit.
Was heißt das genau?
Das sind Koffer, das sind Gegenstände, die im Lager hergestellt wurden, Brillen, Schreibetuis, Fotografien aus den Lagern und aus der Zwangsarbeit, aus der Zeit vor und nach der Verhaftung – also alles Mögliche, was Gefangene mit sich führen, wenn sie in ein Lager deportiert werden. Es gibt Häftlingskleidung und die berüchtigten »OST«-Aufnäher, die NS-Zwangsarbeiter auf ihrer Kleidung tragen mussten. Es ist eine »normale« museale Sammlung – allerdings zivilgesellschaftlich mit großem Engagement aufgebaut. Memorial ist der maßgebliche Protagonist der zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der Geschichte von Stalinismus und Nationalsozialismus im heutigen Russland.
Merkt man an der Ausstattung des Archivs, dass es keine staatliche Unterstützung bekommt?
Das Archiv und die Sammlung sind in vielen kleinen Räumen untergebracht, und natürlich ist das keine staatliche Sammlung mit großen Magazinen, wo die Objekte gelagert werden können. Sondern es ist bis unters Dach vollgestopft. Aber nichtsdestotrotz ist es eine sehr wichtige Sammlung, die nach professionellen Standards inventarisiert wurde.
Worum geht es bei dem Vorwurf der Veteranen, in der Datenbank würden Nazis geführt?
Es geht konkret um 19 Personen, die sich Memorial jetzt noch einmal genau angeschaut hat. Bei 16 Personen wird man zweifelsfrei sagen können, dass sie nach ihrer Haft im Gulag von der sowjetischen oder der russischen Staatsanwaltschaft rehabilitiert wurden. Vier dieser Menschen stehen übrigens auf einer Seite des Verteidigungsministeriums unter der Rubrik »Helden des Krieges«. Bei drei der 19 Personen ist bei der Überprüfung aufgefallen, dass es Zweifel gibt, ob diese Menschen nachträglich rehabilitiert wurden, ihre Verhaftung steht jedoch außer Frage. Die Vorwürfe sind also absurd. Man muss außerdem sagen, dass in dieser Datenbank natürlich nicht nur Menschen geführt werden, die ihr ganzes Leben lang rechtschaffen agiert haben, sondern Menschen, die Opfer politischer Verfolgung geworden sind. Das kann durchaus heißen, dass der eine oder andere nach der Verfolgung durch den Großen Terror der 30er-Jahre in der Sowjetunion mit der deutschen Besatzung kollaboriert hat. Diese Problematik haben wir in Buchenwald übrigens auch, wenn wir uns das sowjetische Speziallager anschauen, in dem sogar die Mehrheit der Insassen als kleine NS-Funktionäre durchaus belastet gewesen ist – gleichwohl war sie Opfer menschenunwürdiger Verfolgung jenseits rechtsstaatlicher Prinzipien.
Sie vertrauen der Expertise von Memorial, sowohl was den Nationalsozialismus angeht als auch in Bezug auf den Stalinismus …
Sicher, zumal wir die Kolleginnen und Kollegen sehr gut kennen. Es sind ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit großer Fachexpertise – wie etwa Irina Scherbakowa, die schon viele Jahre im wissenschaftlichen Kuratorium unserer Stiftung sitzt.
Hat sich Memorial auch dezidiert mit der Verfolgung jüdischer Intellektueller oder von Juden allgemein während des Stalinismus befasst?
Selbstverständlich. Ein Beispiel ist die Familiengeschichte von Irina Scherbakowa, die jüdischer Herkunft ist. Angehörige von ihr sind von den Nazis ermordet worden. Das hat immer auf der Tagesordnung von Memorial gestanden und zeichnet diese Organisation aus: Sie ist auf keinem Auge blind. Sie hat sich – dabei immer auch Unterschiede anerkennend – sowohl der Geschichte des Stalinismus als auch der Verbrechensgeschichte des Nationalsozialismus gewidmet. Natürlich spielen die Schoa und die Geschichte der deutschen Verbrechen eine Rolle, aber auch die antisemitische Verfolgungsgeschichte, die es im Stalinismus gegeben hat.
Welche deutschen Einrichtungen haben sich der Solidaritätserklärung für Memorial angeschlossen?
Alle großen KZ-Gedenkstätten sind dabei: die Stiftungen Brandenburgische und Niedersächsische Gedenkstätten, die Gedenkstätten Buchenwald, Mittelbau-Dora, Dachau, Flossenbürg, Neuengamme und Ravensbrück, die Stiftungen Denkmal für die ermordeten Juden Europas und die Topographie des Terrors in Berlin.
Mit dem Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora sprach Ayala Goldmann.