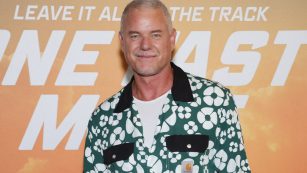Die Bundestagsresolution gegen Antisemitismus an Hochschulen und Schulen offenbart eine tiefere Krise: das Ringen um die Grenzen des Sagbaren in Wissenschaft und Gesellschaft.
Sie wirft zentrale Fragen auf, die weit über die akademische Welt hinausreichen: Welche Normen bestimmen unsere Debattenräume? Wann wird Kritik zu Diskriminierung? Und wie geht eine demokratische Gesellschaft mit Positionen um, die sich zwischen berechtigtem Protest, historisch gewachsenen Feindbildern und moralischer Aufladung bewegen?
Während die Resolution als notwendige Reaktion insbesondere auf den wachsenden israelbezogenen Antisemitismus verteidigt wird, sehen Kritiker in ihr eine problematische Normierung des politischen Diskurses. Doch diese Debatte ist symptomatisch für eine größere Herausforderung: den Umgang mit Konflikten, in denen moralische Überzeugungen, akademische Freiheit und gesellschaftliche Verantwortung untrennbar miteinander verflochten sind.
Universitäten sind Orte der kritischen Reflexion, aber auch der politischen Auseinandersetzung. Sie haben die Aufgabe, Wissenschaftsfreiheit zu schützen, dürfen jedoch nicht zu Räumen werden, in denen antisemitische Narrative geduldet oder gar normalisiert werden. Die zentrale Frage lautet daher: Wo verläuft die Grenze zwischen fundierter Kritik an Israel und antisemitischen Denkfiguren? Und welche Verantwortung tragen Hochschulen, um sowohl eine offene Debatte als auch den Schutz jüdischer Studierender und Hochschulpersonal zu gewährleisten?
Zwischen Normierung und Schutz: Die problematische Regulierung des Diskurses
Die Bundestagsresolution spiegelt einen wachsenden Trend wider, gesellschaftliche Debatten durch normative Vorgaben zu steuern. Die darin vorgegebene Orientierung an Definitionen wie der IHRA-Arbeitsdefinition soll Antisemitismus in all seinen Formen klar benennen. Gleichzeitig führt sie jedoch zu einer problematischen Verschiebung: Selbst analytisch fundierte und an universellen Maßstäben orientierte Kritik an der israelischen Politik kann unter Antisemitismusverdacht geraten.
Diese Entwicklung birgt zwei Gefahren:
1) Eine Verengung des Debattenraums: Die Definition von Antisemitismus wird zunehmend erweitert – mit der Konsequenz, dass bestimmte Narrative vorschnell delegitimiert werden. Dies kann dazu führen, dass kritische wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Menschenrechtsverletzungen, der Siedlungspolitik oder asymmetrischer Gewalt gehemmt werden. Eine Wissenschaft, die sich aus Angst vor Sanktionen selbst zensiert, verliert ihre intellektuelle Integrität.
2) Ein Vertrauensverlust in Antisemitismusprävention: Wenn Maßnahmen zur Bekämpfung von Antisemitismus als politische Steuerungsinstrumente wahrgenommen werden, entsteht der Eindruck, dass es weniger um den Schutz jüdischer Menschen als um die Einschränkung politischer Positionen geht. Dies spielt jenen in die Hände, die ohnehin behaupten, der Antisemitismusbegriff werde strategisch genutzt, um Kritik an israelischer Politik zu delegitimieren oder zu unterbinden.
Beide Entwicklungen gefährden den wissenschaftlichen Diskurs – und damit auch das eigentliche Ziel der Resolution. Denn wenn Schutzmaßnahmen als politische Kontrollmechanismen empfunden werden, wird die Bereitschaft, sich mit realen antisemitischen Tendenzen auseinanderzusetzen, untergraben.
Das reale Problem des israelbezogenen Antisemitismus
Es wäre jedoch eine verkürzte Sichtweise, die Bundestagsresolution ausschließlich als Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit zu kritisieren, ohne das eigentliche Problem anzuerkennen: Israelbezogener Antisemitismus ist an Hochschulen keine Randerscheinung, sondern eine ernstzunehmende Herausforderung – auch wenn antisemitische Vorfälle dort seltener sind als in anderen gesellschaftlichen Bereichen.
Besonders im Kontext des Nahost-Konflikts wird deutlich, wie schnell legitime Kritik in pauschalisierende Feindbilder umschlagen kann. Daher ist eine präzise Auseinandersetzung mit dem Begriff des Antisemitismus unerlässlich. Allerdings erfordert die Wandelbarkeit antisemitischer Phänomene – ebenso wie die Dynamik gesellschaftlicher Diskurse – keine starre Definition, sondern eine kontinuierliche Reflexion und Anpassung, um neue Ausdrucksformen angemessen zu erfassen.
Bestehende Definitionen sind zwar umstritten, doch ihre praktische Anwendbarkeit ist entscheidend. Neben der IHRA-Definition und der Jerusalem Declaration on Antisemitism existieren weitere Ansätze zur Identifikation problematischer Narrative. Ein Beispiel ist der 3-D-Test von Natan Sharansky, der zwischen doppelten Standards, Delegitimierung und Dämonisierung unterscheidet. Trotz berechtigter Kritik an seiner Vereinfachung bleibt er ein nützliches Instrument, um antisemitische Muster zu erkennen, ohne berechtigte Kritik an politischen Entscheidungen zu unterdrücken.
Delegitimierung und Dämonisierung
1) Doppelte Standards: Israel wird nach Maßstäben bewertet, die für andere Staaten nicht gelten. Forderungen, die an keine andere Nation gestellt werden – etwa die Auflösung als Nationalstaat –, sind Ausdruck eines selektiven moralischen Anspruchs.
2) Delegitimierung: Israel wird nicht als souveräner Staat mit spezifischer Politik betrachtet, sondern als illegitimes Projekt – eine Argumentation, die jüdisches Selbstbestimmungsrecht infrage stellt. Die Gleichsetzung mit Apartheid oder Faschismus reduziert einen hochkomplexen geopolitischen Konflikt auf moralische Schlagworte, die politische und historische Zusammenhänge verzerren.
3) Dämonisierung: Israel wird als singulär bösartige Macht dargestellt – sei es durch NS-Vergleiche oder die Behauptung, Israel begehe systematischen Genozid. Solche Narrative reaktivieren alte antisemitische Stereotype über jüdische Macht und Boshaftigkeit.
Diese Denkmuster haben spürbare Folgen. Mit etwa 200.000 Personen stellt die jüdische Gemeinschaft in Deutschland eine kleine Minderheit dar. Angesichts des wachsenden und offen geäußerten Antisemitismus fühlen sich viele Jüdinnen und Juden zunehmend isoliert und schutzlos. Besonders jüdische Studierende berichten von einem Klima, in dem sie sich für ihre Identität oder ihre Haltung zu Israel rechtfertigen müssen.
Antisemitismus zeigt sich dabei nicht nur in offenen Anfeindungen, sondern auch in subtilen Formen sozialer Ausgrenzung. Wer Schutzmechanismen gegen diesen Antisemitismus als bloße Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit abtut, verkennt die strukturelle Dimension des Problems.
Die Verantwortung der Universitäten: Jenseits von Moralisierung und Beliebigkeit
Hochschulen stehen folglich vor einem doppelten Dilemma: Sie dürfen keine Räume für Antisemitismus bieten, müssen aber zugleich verhindern, dass die Debatte über Israel durch moralische Eindeutigkeiten erstickt wird. Die Gefahr besteht darin, dass eine rein normative Definition von Antisemitismus entweder zu einer restriktiven Diskurskontrolle oder zu einer Symbolpolitik führt, die reale Probleme nicht löst. Universitäten müssen daher eine reflektierte Abwägung treffen: Antisemitismus konsequent bekämpfen: Nicht nur offene Anfeindungen, sondern auch subtilere Formen israelbezogenen Antisemitismus müssen erkannt und benannt werden. Der Schutz jüdischer Hochschulangehöriger ist kein verhandelbares Gut!
Eine kritische Auseinandersetzung mit israelischer Politik muss möglich bleiben – aber sie muss sich wissenschaftlichen und ethischen Standards unterwerfen. Universitäten müssen verhindern, dass legitime Debatten durch Moralisierung unterdrückt werden oder dass problematische Narrative unter dem Vorwand der Wissenschaftsfreiheit normalisiert werden. Diskursräume schaffen, nicht schließen: Polarisierung kann nur durch Formate der reflektierten Auseinandersetzung begegnet werden. Hochschulen sollten keine Dogmen reproduzieren, sondern Räume schaffen, in denen differenzierte Perspektiven zugelassen werden.
Reflektierte Balance statt moralischer Gewissheiten
Die Bundestagsresolution reflektiert eine tiefere gesellschaftliche Herausforderung: den Umgang mit einem Konflikt, der historische Traumata, geopolitische Interessen und identitätspolitische Spannungen vereint. Weder pauschale Meinungsbeschränkungen noch uneingeschränkte Meinungsfreiheit bieten tragfähige Lösungen. Universitäten müssen dieser Herausforderung mit wissenschaftlicher Präzision und gesellschaftlicher Sensibilität begegnen.
Denn Wissenschaftsfreiheit bedeutet methodengeleitete Erkenntnissuche nach wissenschaftlichen Standards, während Meinungsfreiheit individuelle Äußerungen unabhängig von ihrer Begründung schützt. Doch Wissenschaft darf sich weder in normativen Setzungen verlieren noch einer vermeintlichen Neutralität erliegen, die Antisemitismus als bloße Meinungsäußerung verharmlost.
Eine reflektierte Balance bedeutet nicht, einfache Antworten zu formulieren, sondern Widersprüche auszuhalten und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Antisemitismus klar zu benennen und den wissenschaftlichen Diskurs zu schützen, sind keine Gegensätze – sie bedingen einander: Nur eine offene, differenzierte Auseinandersetzung ermöglicht es, antisemitische Muster sichtbar zu machen und ihnen entgegenzutreten, ohne dabei kritische Debatten vorschnell zu diskreditieren.
Wissenschaftsfreiheit darf nicht als Vorwand für die Verbreitung destruktiver Narrative missbraucht werden, sondern muss als Grundlage für eine argumentativ fundierte Auseinandersetzung dienen, die antisemitische Strukturen erkennt und problematisiert. Dies bedeutet vor allem: Universitäten müssen Orte der verantwortlichen Debatte bleiben – Räume, in denen wissenschaftliche Freiheit und der Schutz vor Diskriminierung nicht in Konkurrenz stehen, sondern sich wechselseitig stärken.
Der Autor ist Judaist und hat an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg eine Professur für Jüdische Studien/Religionswissenschaft inne.