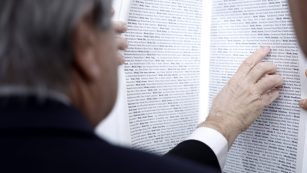Seit dem russischen Überfall suchten in Deutschland 1.139.689 Menschen aus der Ukraine Schutz und Sicherheit – die höchste Anzahl Geflüchteter seit dem Zweiten Weltkrieg. 80 Prozent von ihnen sind Frauen, die überwiegende Mehrheit davon kam ohne Partner, viele mit ihren Kindern. Diesen Menschen mit traumatischen Erfahrungen und ihren Sorgen um im Kriegsgebiet verbliebene Angehörige psychosoziale Hilfe und Unterstützung anzubieten, läge auf der Hand.
Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, stellt stattdessen die von ihren Amtsvorgängerinnen ins Leben gerufenen Maßnahmen zum Empowerment von Frauen, Kindern und vulnerablen Geflüchteten lieber ein – aus Mangel an finanziellen Mitteln, wie es heißt. Betroffen davon ist auch das bundesweit einzige Projekt in jüdischer Trägerschaft, und zwar »Brückenbau – Vielfalt begegnen«, eine Kooperation der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST), Olam Aid (vormals IsraAid) sowie der jüdischen Gemeinde Bochum-Herne-Hattingen.
Beteiligung der jüdischen Zivilgesellschaft an der Aufnahme Geflüchteter
Die Beteiligung der jüdischen Zivilgesellschaft an der Aufnahme Geflüchteter war für Frau Özoguz seinerzeit ein persönliches Anliegen, Bundeskanzlerin Merkel würdigte die Arbeit des Projektes 2018 mit der Verleihung des Nationalen Integrationspreises.
Für die Integrationsbeauftragte, die zudem Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus ist, scheinen frühere Erfolge und aktuelle Herausforderungen wenig Bedeutung zu haben. Unter den Geflüchteten, die sich im Rahmen des Projektes mit eigenen sozialen Angeboten wie Sprachcafés und Wohnungslosenhilfe für die Aufnahmegesellschaft engagiert haben, herrscht Unverständnis über die Entscheidung, viele von ihnen betonen, dass die therapeutischen und psychosozialen Angebote von Brückenbau ihnen die Kraft gegeben hätten, sich zu einem aktiven, engagierten Part der deutschen Gesellschaft zu entwickeln.
Der Autor ist Leiter des Berliner Büros der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST).