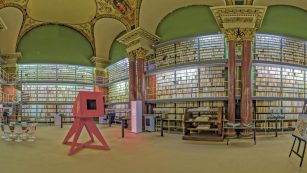Herr Raichel, in der Regel spielen Sie mit »großem Orchester« – bisher mit rund 100 Musikern aus aller Welt. Jetzt sind Sie quasi solo auf Tournee. Warum das?
Für diese Tournee durch Europa, Japan, Korea und aktuell durch die USA habe ich mich entschlossen, ein Klavierkonzert zu geben. Ich wollte nach zehn Jahren zur Essenz meiner Musik zurückkehren und einfach nur die Melodien auf intime Weise spielen, am Klavier, so wie sie einst geschrieben wurden. Ich wollte zurück zur DNA meiner Songs.
Welche DNA ist das?
Unterm Strich ist es israelische Musik. Wenn ich eine Aufnahme mit der Sängerin Marta Gómez aus Kolumbien mache, mit der Fado-Sängerin Ana Moura aus Portugal oder dem Countertenor Andreas Scholl aus Deutschland, dann klingt das letztendlich nicht nach kolumbianischer Musik, Fado oder Klassik aus Deutschland. Es klingt vielmehr nach israelischer Musik.
Israelische Musik? Allgemein gelten Sie als führender Vertreter der Weltmusik.
Ich bin mit dem Akkordeon aufgewachsen, das eigentlich ein Weltmusik-Instrument par excellence ist. Aber ich spiele darauf israelische Musik. Es kommt natürlich darauf an, wie man israelische Musik definiert. Israel ist ein junges Land, und alle 15 Jahre kommen Immigranten aus anderen Erdteilen dorthin, die nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Küche und die Klanglandschaft verändern. Meine Songs sind in dem Sinne israelische Musik, als sich diese Vielfalt darin spiegelt. Ich glaube, man kann darin auch Spuren meiner deutschen und meiner polnisch-russischen Vorfahren hören.
Wann hat sich Ihr typischer Stil geformt?
Als ich in der Zahal gedient habe. Ich habe dort als Armeemusiker täglich vor Soldaten gespielt. Soldaten sind die ehrlichsten Zuhörer – nach Kindern. Du stiehlst ihnen die verdiente Ruhepause, wenn du nicht gut bist. Also bekommst du sofort Feedback. Das war eine gute Erfahrung. Zwar hat das nicht meine Einstellung zur Musik verändert, aber ich habe viel über Aufführungspraxis gelernt.
Was haben Sie als Soldat musikalisch noch gelernt?
Ich bin dort zum ersten Mal mit äthiopischer Musik in Berührung gekommen. Zahal ist ein Schmelztiegel. Menschen aus ganz Israel dienen dort, gleich welcher Herkunft. Beim Militär habe ich Einwanderer aus Äthiopien getroffen und die Musik gehört, die sie von zu Hause mitgebracht hatten – eine Musik mit vielen Fans, die aber im israelischen Mainstream-Radio nicht vorkam. Der große Wandel, der vom »Idan Raichel Project« ausging, war, dass es die Stimme der Minderheiten, der Menschen auf der Straße und ihre Sprache in die großen Sender gebracht hat.
Arabische Musik ist dort immer noch selten zu hören.
Die israelische Gesellschaft ist nicht vertraut mit der Musik der Beduinen oder der Drusen, mit Musik, die aus Ramallah, Jericho oder Bethlehem kommt. Nicht einmal die Kids lernen etwas darüber. Wenn du jemanden in Tel Aviv fragst, ob er den Namen eines palästinensischen Sängers kennt, wird er »Nein« sagen. Und wenn du nach einem Kinofilm aus dem Libanon oder einer modernen syrischen Tanzgruppe fragst, wird die Antwort ebenfalls »Nein« lauten. Umgekehrt gilt das Gleiche natürlich auch für Menschen aus Syrien oder dem Iran, wenn du sie fragst, ob sie einen Sänger oder einen Film aus Israel kennen. Auch sie werden sagen: »Nein«.
Wie ließe sich das ändern?
Ramallah ist nur 20 Kilometer von Jerusalem entfernt, sozusagen auf der anderen Straßenseite. Es sollte ein Muss für das israelische Erziehungssystem sein, den Kindern etwas über die Kultur jenseits der Mauer beizubringen.
Schwer in diesen Zeiten. Wie haben Sie den Gaza-Krieg erlebt?
Ganz Israel war Kriegszone. Bis dahin dachte man, Krieg sei etwas weit weg hinter der Grenze, weil die Kämpfe nicht dort stattfinden, wo man lebt. Doch dann traf eine Rakete meine Straße, beziehungsweise die Überreste der Rakete, weil der Iron Dome funktioniert hat. Es gab Alarm, dann plötzlich eine Explosion, und dieses Ding fiel vom Himmel. Mitten in Tel Aviv. Du weißt, es ist Krieg, aber du spürst ihn nicht bis zu diesem Knall. Du siehst ihn zwar im Fernsehen, du weißt, er ist nur 50 Kilometer entfernt, du weißt, dass es verwundete Soldaten gibt – aber plötzlich siehst du die Splitter dieser Rakete.
Hatten Sie Angst? Wollten Sie weg?
Wenn man in Israel lebt, ist man so etwas gewöhnt, so verrückt das klingen mag. Selbst als Busse von Selbstmordattentätern in die Luft gesprengt wurden, hat uns das nicht vom Busfahren abgehalten. Man gewöhnt sich daran. Sogar Terror hat einen Gewöhnungseffekt.
Sieht Ihre – nichtisraelische – Frau das auch so?
Meine Frau ist Wienerin. Als die Raketen einschlugen, war es schwer für sie, zu verstehen, warum ich in Tel Aviv bleiben wollte, wo ich doch die Wahl gehabt hätte, nach Österreich zu gehen. Doch ich glaube, es ist meine moralische Pflicht, hierzubleiben. Wir Menschen im Nahen Osten ticken da einfach anders.
Glauben Sie noch an Frieden?
Reden wir von Frieden? Oder eher von einer Nicht-Kriegssituation? Das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, die meisten Menschen im Nahen Osten wollen eine Nicht-Kriegssituation und keinen Frieden. Es ist nicht so, dass den Kindern die Liebe zu einer fremden Kultur beigebracht wird. Es gibt aber große Hoffnungen, dass die anderen keine Raketen mehr auf uns schießen.
Apropos Kinder: Sie sind kürzlich Vater einer Tochter geworden. Wie hat das Ihr Leben verändert?
Es wird jetzt viel Deutsch im Haus gesprochen. Meine Großmutter wurde in Berlin geboren, und da meine Urgroßeltern kein Wort Hebräisch verstanden, als sie nach Israel kamen, mussten alle, auch meine Mutter, Deutsch mit ihnen sprechen. So können sich jetzt meine Mutter und meine Frau auf Deutsch unterhalten. Nur ich verstehe nichts. Dabei läuft ständig eine deutsche Kinderkassette mit Pippi Langstrumpf oder Nena. Und manchmal höre ich seltsame Sachen wie »Um Gottes Willen«. Dann weiß ich: Oha, jetzt gibt’s Ärger.
Das Gespräch führte Jonathan Scheiner.
Idan Raichel wurde 1977 in Kfar Saba geboren. Heute lebt er in Tel Aviv mit seiner Frau Damaris und Tochter Philipa. Bekannt wurde der Sänger, Texter und Komponist mit seinem vor elf Jahren gegründeten »Idan Raichel Project«, das elektronische Musik mit traditionellen hebräischen Texten sowie nahöstlicher und äthiopischer Musik verschmilzt. Raichel ist in Israel ein
musikalischer Superstar. Von seinen bislang fünf Alben wurden 560.000 Exemplare verkauft.