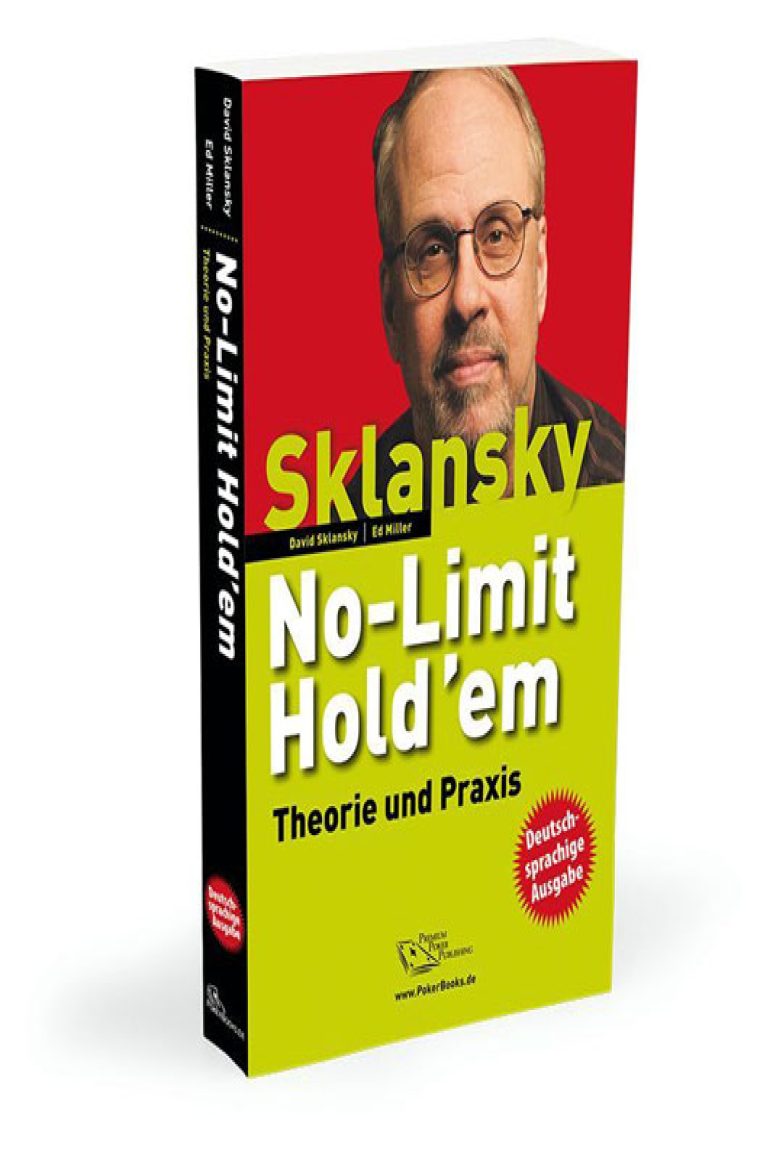Wann immer ein Pokerturnier stattfindet und am Ende ein glücklicher Gewinner sein Geld einstreicht, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein großer Teil der Anwesenden durch das Buch eines amerikanischen Juden zum Spiel und zum Erfolg gekommen ist. Der heute 65-jährige David Sklansky beschäftigt sich in seinen in 15 Sprachen übersetzten Werken mit der Theorie des Pokerns, zu der Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Logik unabdingbar hinzugehören.
Außerhalb des Poker-Universums kommt diese Rationalität nicht immer gut an. So machte Sklansky im Dezember 2006 mit einer Wette international auf sich aufmerksam. Er wolle demjenigen 50.000 Dollar zahlen, der 1.) fest an die Auferstehung Jesu und 2.) daran glaube, dass alle Nichtchristen in die Hölle kommen, um ihn 3.) in einem mathematischen Standardtest zu schlagen, verkündete er. Allerdings mussten potenzielle Bewerber einen Lügendetektortest bestehen, um zu beweisen, dass sie tatsächlich gläubig seien. Er gehe nämlich nicht davon aus, sagte Sklansky, dass jemand, der derart Unlogisches glaube, gut in rationalem Denken sei.
Nachdem sich Ken Jennings, ein Mormone, der als erfolgreichster Teilnehmer der populären US-Quizshow Jeopardy zu einer TV-Berühmtheit geworden war, über Sklanskys »Arroganz« beschwert hatte, empörten sich viele Christen über den Pokerprofi, der kühl erklärte, er sei sicher, dass niemand seine Herausforderung annehmen würde. Bis heute hat sich tatsächlich keiner gefunden, der überzeugt ist, den Lügendetektortest zu bestehen und anschließend im Mathe-Test besser abzuschneiden als Sklansky.
unterfordert Letzteres wäre wohl für die meisten Menschen, unabhängig von ihrem Glauben, ziemlich schwer: Der am 22. Dezember 1947 geborene Pokerspezialist ist Sohn eines Mathematikprofessors an der Columbia University, der seine Liebe zu Zahlen, Formeln und Logik an den Nachwuchs weitergab. »Meiner Frau gefiel es nicht, aber ich brachte David ständig Mathematik bei«, erinnerte sich Irving Sklansky später.
Während seine Mutter hoffte, dass eines Tages ein Mediziner aus ihm werde, erreichte der kleine David bereits im Alter von zwölf Jahren im Mathe-Teil des amerikanischen Studierfähigkeitstests SAT die Höchstpunktzahl – und begann nach der Highschool mit dem Studium an der zur Universität von Pennsylvania gehörenden Wharton School of Business. Rund zwölf Monate arbeitete er anschließend als Anlageberater, bis er schließlich seinen Job hinwarf und professioneller Pokerspieler wurde. Später erzählte Sklansky, er sei von der Arbeit derart unterfordert gewesen, dass er die meiste Zeit damit verbrachte, Wahrscheinlichkeiten im Poker auszurechnen. Poker ist schließlich kein reines Glücksspiel. Für jedes Blatt, das ein Spieler auf der Hand hat, kann die Wahrscheinlichkeit berechnet werden, mit der er mit diesen Karten die Runde gewinnen kann.
vernunft Sklansky bevorzugte die damals relativ unbekannte, aber heute beliebteste Pokervariante, das No-Limit Hold’em. Hierbei bekommt jeder Spieler zwei Karten, danach wird eine Runde gesetzt. Anschließend werden drei Karten offen ausgelegt, danach wird wieder gesetzt. Es kommt eine weitere offene Karte hinzu, gefolgt von einer weiteren Runde Setzen, dann wird eine fünfte Karte aufgedeckt, und die Spieler dürfen ein letztes Mal ihre Einsätze erhöhen. Gewonnen hat der Spieler, der aus den fünf offenen Gemeinschaftskarten und seinen beiden eigenen die beste Kombination aus fünf Karten bilden kann.
Für den Zuschauer ist also bei jeder Setzrunde sehr einfach zu berechnen, wie die Chancen eines Spielers stehen. Doch obwohl der Spieler selbst diese genauen Zahlen nicht wissen kann – er kennt ja nur die eigenen Karten und muss daher raten, welche Karten die anderen am Tisch auf der Hand haben könnten –, sollte er diesen Zahlen trotzdem nachträglich Beachtung schenken.
Denn nach Sklansky ist Verlieren gar nicht so schlimm: Man solle sich dann als Gewinner fühlen, wenn man zu dem Zeitpunkt, an dem man Geld gesetzt hat, aufgrund der Wahrscheinlichkeit richtig gehandelt hat, erklärt er gern. Selbst wenn danach der – unwahrscheinlichere – Fall eintritt und man dennoch verliert. Denn auch, wenn diese Haltung die verlorenen Einsätze nicht zurückbringe, komme man doch besser über das Gefühl des Verlusts hinweg, wenn man wisse, dass man eigentlich vernünftig gehandelt hat.
Langfristig hat man im Poker nämlich nur durch die richtigen Entscheidungen Erfolg. Je mehr Runden gespielt werden, desto weniger entscheidet bloßes Glück über Sieg oder Niederlage. Allerdings merkt Sklansky an: »Wenn wir spielen, müssen wir uns immer darüber im Klaren sein, dass wir dies tun, um zu gewinnen.« Und gewonnen hat er ziemlich oft, mehr als eine Million Dollar während seiner bisherigen Karriere, dazu drei der begehrten »World Series of Poker«-Bracelets, kostbare goldene Armbänder, die den Gewinnern der Hauptturniere oder der kleineren Turniere während der World Series geschenkt werden.
insider-tipps Als David Sklansky sich entschied, Profispieler zu werden, galt Poker noch als anrüchiges Glücksspiel. Der Mathematikbegeisterte beließ es allerdings schon bald nicht nur beim Ansehen von Karten und Ausrechnen von Wahrscheinlichkeiten, sondern gründete gemeinsam mit einem Freund den Buchverlag »Two Plus Two«, der sich mittlerweile zum marktführenden Anbieter von Büchern zu den Themen Poker und Glücksspiel entwickelt hat. Das dazugehörige Internetforum wurde weltweit bekannt, als man dort den Betrugsskandal um die bis dato führende Online-Pokerplattform UltimaBet mit aufdeckte, bei dem zwischen 2005 und 2007 durch eine Sicherheitslücke Spieler als sogenannter Superuser die Karten ihrer Gegner einsehen konnten.
Als 1976 sein erstes Buch Hold’em Poker erschien, rechnete allerdings wohl auch Sklansky nicht mit derartigen Erfolgen. Im Gegenteil, die anderen Pokerprofis waren ernsthaft wütend auf ihren Kollegen. Er verrate Tricks, die der Öffentlichkeit bislang nicht bekannt gewesen seien, lautete ein Vorwurf, außerdem gebe er Insider-Tipps an Laien weiter. Es dauerte nicht lange, bis Sklanskys Kritiker verstummten, denn durch das Buch wurden zahlreiche neue Pokerspieler angezogen, die Verdienstmöglichkeiten größer – und nach und nach verlor das Spiel sogar sein Schmuddel-Image.
1979 gewann mit dem mittlerweile verstorbenen Hal Fowler erstmals ein Amateur das Main Event der World Series of Poker. Entsprechend stieg die Nachfrage nach den Büchern von Sklansky, denn erfolgreich zu spielen, schien nun auch für Nichtprofis möglich zu sein. Schließlich wurde Texas Hold’em sogar in den großen Casinos angeboten – dabei hatte diese Pokervariante lange als ein Spiel gegolten, das »nur Texaner und Juden« spielen.