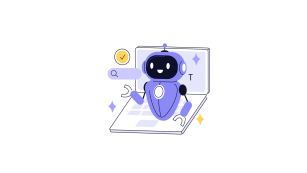Michel Bergmanns erster Roman Die Teilacher, der im Rückblick jüdisches Leben in den frühen Nachkriegsjahren in Frankfurt am Main beschreibt, erschien im Frühjahr 2010 und war für ein Debüt ein ausgesprochener Erfolg. Das mit viel Wärme und Humor beschriebene Milieu der »Teilacher«, überlebender jüdischer Handelsvertreter, die den Deutschen mit Witz und Tricks Wäschepakete verkauften, kennt der 1945 in einem Schweizer Internierungslager geborene und in der Mainmetropole aufgewachsene Sohn jüdischer Rückkehrer aus seiner eigenen Jugend. Jetzt ist mit Machloikes die Fortsetzung erschienen.
wohlstand Machloikes (das jiddische Wort bedeutet Durcheinander, Zwiespalt, Zwist) spielt 1953/1954. David Bermann – neben seinem Ziehsohn Alfred die zentrale Figur – und viele seiner Freunde sind in Deutschland geblieben, obwohl sie eigentlich in die USA, nach Israel oder Australien weiterziehen wollten. »Die wilden Jahre waren vorbei, und langsam begannen die Wunden zu vernarben«, beschreibt Bergmann die Atmosphäre der damaligen Zeit.
»Die Kaffeehäuser und Gaststätten waren gut besucht. Man gönnte sich wieder was.« Wobei Frankfurt in den frühen 50-ern keine heile Welt ist. Der beginnende Wohlstand ist hart erarbeitet und steht oft noch auf wackeligen Beinen. Solidarität ist in der jüdischen Gemeinschaft zwar verbreitet, jedoch nicht immer oberstes Gebot.
Zu Beginn des Romans sitzt der 15-jährige Alfred Kleefeld wie so oft mittags mit »Onkel David« in dessen Stammcafé. Mit dabei Davids Freunde Emil Verständig, dem die Gestapo ein Auge ausgeschlagen hat, und Jossel Fajnbrot, dessen Aussehen Alfred an einen Gangster aus dem Chicago der 30er-Jahre erinnert. Die drei Vertreter diskutieren mal wieder lebhaft in ihrem jiddisch gefärbten Deutsch. Dieses Mal über die Frage, ob ihr Kollege Robert Fränkel ein Verräter ist.
Fränkel, früher in Berlin Schauspieler, war Fajnbrot und Verständig schon immer suspekt: »Er ist ein linker Vogel! Stell dir vor! Ich habe schon immer gesagt, er ist ein arroganter Potz! Moische Wichtig!« Und überhaupt: Hat er nicht mit den Nazis kollaboriert?
bahnhofsviertel Wie auch immer. Fränkel macht jedenfalls nicht mehr von Tür zu Tür in Wäsche, sondern hat ein Teppichgeschäft im Bahnhofsviertel eröffnet, das bald sehr gut läuft. Seine Angestellten sind: ein traumatisierter, mürrischer alter Mann »mit Auschwitz-Karriere«, der zwanghaft Listen führt; ein hundertprozentiger Goj aus einer unbelehrbaren Nazifamilie, der »eine pathologische Liebe zu Juden entwickelt hat«; und der junge Blum, der diesen Job als Sprungbrett für eine Karriere als Hehler und Schwarzhändler nutzt.
Auch der junge Alfred arbeitet aushilfsweise bei Fränkel. Mit dem Geld, das er dort verdient, kann er sich sein erträumtes Fahrrad kaufen und damit die feenhafte Juliette aus reichem Elternhaus beeindrucken.
Bergmann verknüpft subtil mehrere Handlungsstränge: Einer dreht sich um David, Alfred und deren Freunde und Familie – David und Alfreds Mutter leben nach vielen Hindernissen endlich zusammen. Der zweite ist Fränkels Teppichgeschäft, in dessen Umfeld der legale und illegale Handel blüht.
Ein dritter Schauplatz ist das Hauptquartier der US Army, wo Fränkel wochenlang verhört wird. Er soll erklären, warum sein Name in so vielen Akten der SS auftaucht. Dass er als geborener Entertainer im Lager ausgewählt wurde, um Hitler Witze beizubringen, glaubt ihm zunächst niemand.
Die Frage, wie man als Jude nach allem, was passiert ist, weitermachen kann, steht auch Mitte der 50er-Jahre weiter im Raum. Gleichzeitig pendelt die jüdische Nachkriegsgeneration zwischen den Welten: Alfred bewegt sich unter Juden, die sich langsam etablieren, ebenso selbstverständlich wie unter den »Einheimischen« und bei den amerikanischen Besatzern.
türöffner Da er seine ersten Lebensjahre in den USA verbracht hat, spricht er perfekt Englisch. Ihm öffnen sich Türen, die nicht nur der Generation seiner Eltern, sondern auch den meisten Gleichaltrigen verschlossen bleiben. Doch es treibt ihn auch früh die Frage um: Wer bin ich und wo gehöre ich hin?
Den Zwiespalt der jüdischen Rückkehrer macht eine Romanszene besonders deutlich. Als die deutsche Fußballnationalmannschaft 1954 Weltmeister wird, jubeln alle, nur die Teilacher nicht. Sie stehen unter Schock: »Die Deutschen hatten den Zweiten Weltkrieg doch noch gewonnen!« Doch dann versuchen sie, das Beste daraus zu machen. Sie bieten »weltmeisterliche« Preise und nennen ihre Wäschekollektionen »Helmuth Rahn« und »Fritz Walter«.
Michel Bergmann: »Machloikes«, Arche, Zürich und Hamburg 2011, 288 S., 19,90 €