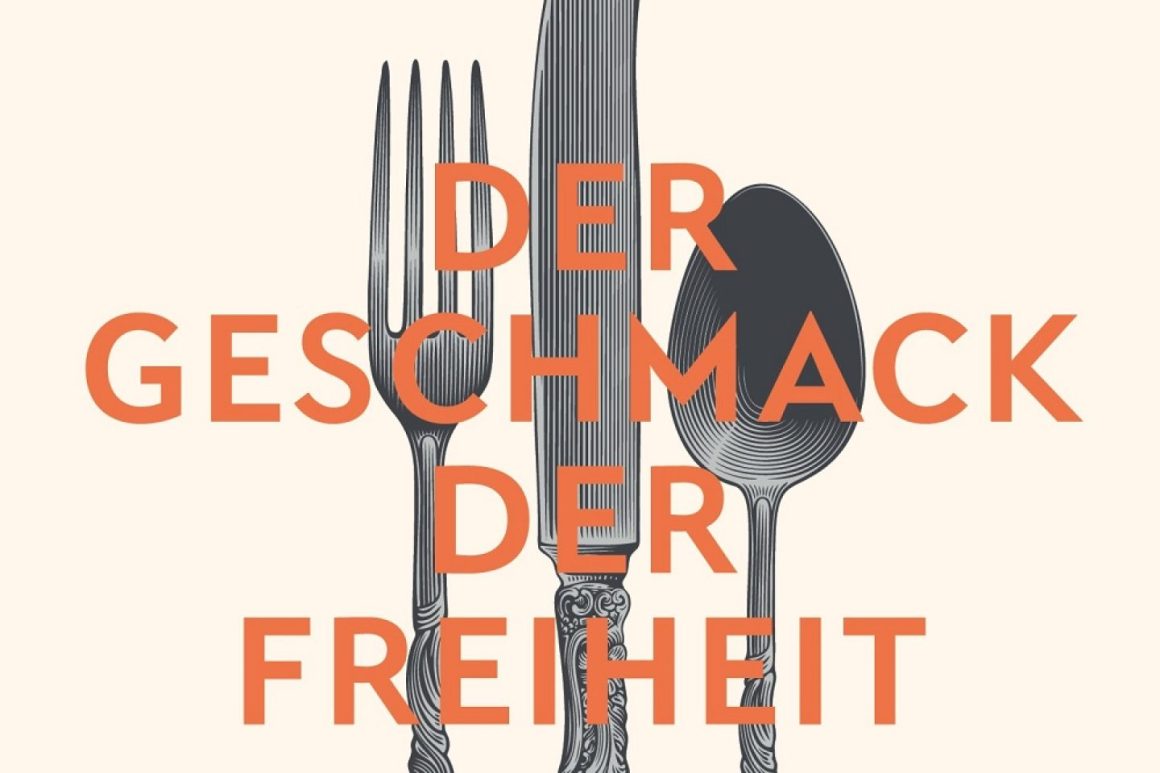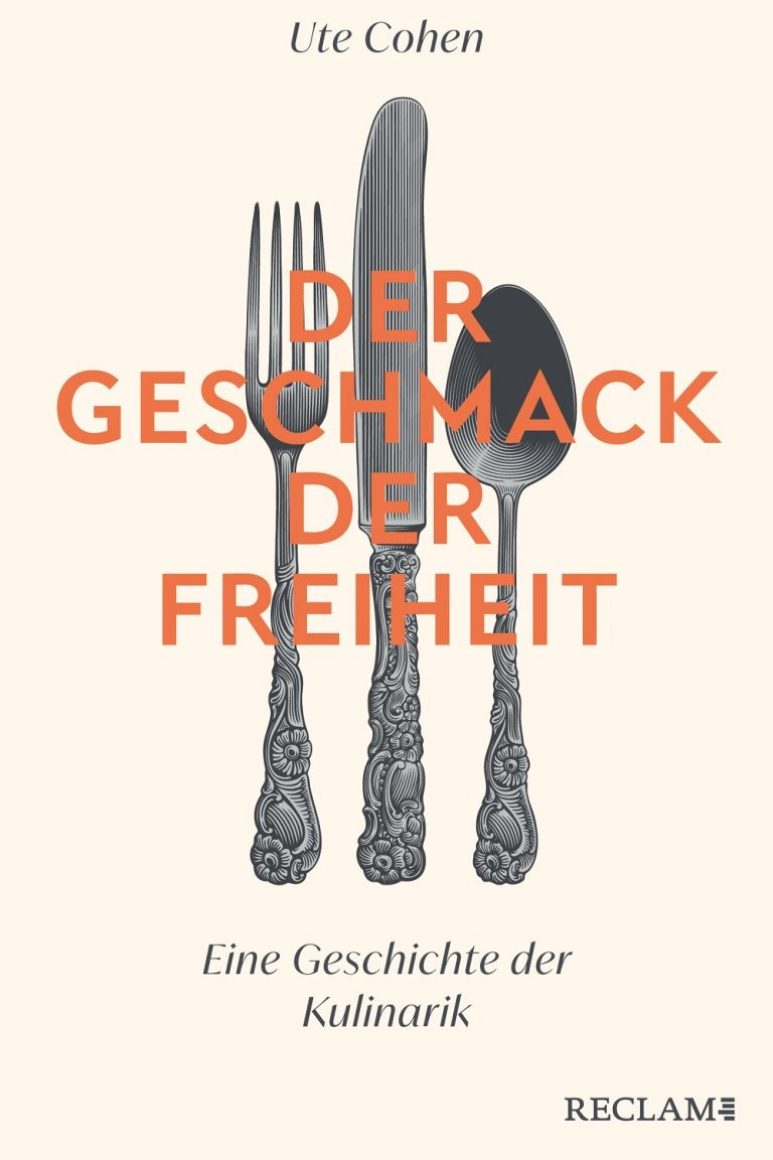Für Ute Cohen ist Religion wie Champagner: »Sie braucht Leib und Seele, um zu prickeln«, sagt die Autorin. Deshalb gibt es in ihrem neuen Buch »Der Geschmack der Freiheit«, das am 19. Juli im Reclam Verlag erscheint, auch viele Querverweise zur Spiritualität. Im Interview spricht die Katholikin, die lange Zeit mit ihrem jüdischen Ehemann in Paris lebte, darüber, wie man zwischen der »Gefahr der Maßlosigkeit« und »zu strikten Regeln« den Weg zu echter Freiheit und Genuss finden kann.
Frau Cohen, in Ihrem Buch »Der Geschmack der Freiheit« sagen Sie, dass die Freiheit durch den Magen gehe. Muss man erst frei sein, um das Essen genießen zu können, oder setzt die Erlangung der Freiheit ausreichend Kraft durch stärkende Mahlzeiten voraus?
Beides ist der Fall. Wer Zwängen ausgesetzt ist, vermag schwer, zu genießen. Genuss braucht Freiheit. Dass Freiheit kein Kinderspiel ist, sondern regelrecht einen Kraftakt bedeuten kann, setzt voraus, dass man sich auch physisch stärkt. Es verhält sich nicht anders als mit der Liebe, die ja, so der Volksmund, durch den Magen geht. Die menschliche Existenz vom Bauch her zu denken, ist auf jeden Fall ein sinnlicherer Ansatz als die verkopfte Variante. Freiheit als rein geistiges Exerzitium ist ein sprödes Unterfangen. »Der Mensch ist, was er isst«, mit Ludwig Feuerbach gesprochen.
In Ihrem Buch schildern Sie, wie im Umfeld der Französischen Revolution die Restaurants entstanden sind. Warum war diese Gleichzeitigkeit kein historischer Zufall, sondern ein Symptom der Emanzipation des bürgerlichen Geschmacks?
Gesellschaften wandeln sich nicht nur über neue Gedanken. Gefühle wie Angst, Wut oder auch Freude haben eine geschichtsverändernde Kraft. Die drei Grundideen der Französischen Revolution - Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit - mussten verinnerlicht werden. Es reichte nicht mehr, die Mägen zu stopfen, um Aufruhr zu vermeiden. Die Revolutionäre wollten sich das ganze Potenzial des Volkes, Herz, Leib und Verstand, zunutze machen. Freiheit zeigte sich als Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Gerichten. Gleichheit zeigte sich an Tischen, an denen es keine Hierarchien gab. Brüderlichkeit bedeutete ein neues Miteinander. Bei Tisch entschied sich der soziale Zusammenhalt. Wenn die Tassen fliegen, hat das freie Individuum versagt.
Etwas ambivalent wirkt beim Thema Essen die Kirche: Einerseits warnte man stets asketisch vor Genussmitteln und allzu großer Opulenz, andererseits haben die Klöster immer schon das leibliche Wohl im Blick gehabt. Ein Benediktinermönch namens Dom Perignon, schreiben Sie, könnte sogar den Champagner erfunden haben. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?
Beim Champagner scheiden sich die Geister. Die Engländer behaupten die Erfindung für sich, die Franzosen ohnehin. Ich neige dem guten alten Dom Perignon zu, denn mit Melasse und Gewürzen hätte er sein edles Getränk nicht vermischt. Da haben sie schon die Antwort auf Ihre Frage! Dom Perignon war Purist und Genießer zugleich. Es war ihm an Perfektion gelegen, und das bedeutet auch Verzicht. Wahrer Genuss setzt Formgebung voraus, und darin ist die Kirche ja Spezialistin. Zugleich weiß sie auch um die Gefahr der Maßlosigkeit und versucht diese zu vermeiden. Mit manchmal vielleicht zu strikten Regeln, aber Religion ist wie Champagner: Sie braucht Leib und Seele, um zu prickeln.
Wenn man auf moderne Speisetrends schaut, kann man den Eindruck bekommen, dass Moral und Essen immer noch eng zusammengehen. Platt gesagt: Manche Speisen sind böse, andere - zum Beispiel vegetarisch oder vegan - sind gut. Woher rührt diese anhaltende Lust zur Unfreiheit beim Essen? Sollte nicht jeder so satt werden dürfen, wie er will - auch wenn er es auf ungesunde Weise tut?
Spontan würde ich mit Ja antworten. Allerdings gilt auch beim Essen, was für die Freiheit gilt: Jeder soll sich frei entfalten, solange kein anderer dabei zu Schaden kommt. Ist das schon der Fall, wenn jemand zügellos bis zur Fettleibigkeit isst? Belastet er dadurch das Sozialsystem? Das sind Fragen, die austariert werden müssten in einer Gesellschaft, aber nicht über Verbote geregelt werden sollten. Veggie Days sind nichts anderes als eine säkularisierte Form kirchlicher Nahrungsmittelreglementierung, werden aber ungewöhnlich heftig eingefordert. Vegetarier umgibt ein fast schön religiöser Nimbus. Zur Beichte gehen für Foie gras (Gänsestopfleber)? Das sollte jeder selbst mit seinem Gewissen ausmachen.
Gerade die Franzosen bilden sich viel auf ihre Kochkunst ein. Dazu gibt es in jedem Land unzählige regionale Küchen. Zeugt es von »identitärer Verengung«, wenn man sich an eine nationale oder regionale Küche klammert?
Mich amüsiert die französische Koketterie. Ein bisschen verliebt bin ich schon in die französische Küche! In Bayern geboren, genauer gesagt in Franken, weiß ich aber, dass es mehr gibt als Nationen, anderes als Internationales. Küchenchauvinisten sollen bleiben, wo der Pfeffer wächst. Genauso wenig behagt mir aber ein fader Mischmasch. Köstlicher ist es doch, wenn Kochstile sich gegenseitig bereichern.
Das Gespräch führte Stefan Meetschen.
Ute Cohen, »Der Geschmack der Freiheit«, 272 Seiten, 24 Euro