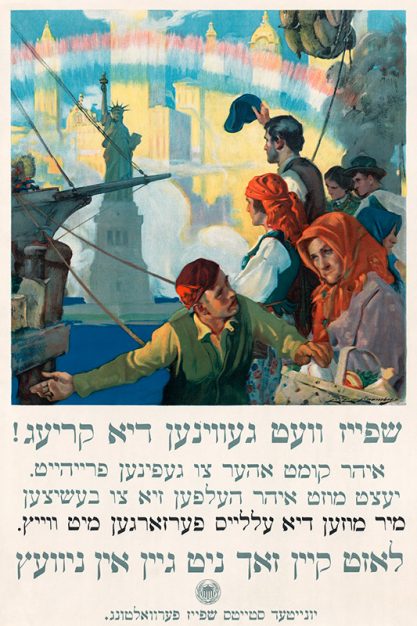Alles andere als Langeweile kam jüngst auf, als Donald Trump in Medien wie der Washington Post und dem Magazin Forbes hektische Kommentare über ein jiddisches Wort auslöste. Der Präsidentschaftskandidat hatte auf Hillary Clintons derbe Vorwahlniederlage im Jahr 2008 gegen den damaligen Senator Obama mit dem Satz »She got shlonged!« verwiesen und dabei ein auch als Vulgarismus deutbares Wort benutzt.
Als sich dies für den Republikaner zum fatalen »Shlongedgate« auszuwachsen drohte, beruhigte dessen Sprecherin die Gemüter: Trump habe sich von dem Linguisten Chaim Pippick für Folgereden eine Liste beliebter Jiddismen besorgt. Darunter seien neben »schlep« auch »schlemiel«, »schlemazzle«, »schlub«, »schmutz«, »schmegegge« und »schnook«.
wiederbelebung Dass jiddischstämmige Wörter in der amerikanischen Umgangssprache oft verwendet werden, sagt indes nichts über die Zukunftschancen des Jiddischen als Gesamtsprache aus. Der – in politischer Hinsicht mehr als fragwürdige – Historiker Shlomo Sand von der Universität Tel Aviv äußert sich in seinem Buch Warum ich aufhöre, Jude zu sein: ein israelischer Standpunkt (2013) pessimistisch.
»Schätzungen zufolge sprachen vor dem Zweiten Weltkrieg mehr als zehn Millionen Menschen verschiedene Dialekte des Jiddischen. Anfang des 21. Jahrhunderts sind von ihnen nur einige Hunderttausende, hauptsächlich ultraorthodoxe Charedim, übrig geblieben. Eine ganze Volkskultur wurde unwiederbringlich ausgelöscht, denn es besteht keinerlei Hoffnung, eine einmal ausgestorbene Kultur oder Sprache jemals wiederzubeleben«, heißt es bei Sand.
Die deutsch-amerikanische Schauspielerin Peggy Lukac erklärte schon 2003, die sterbende Sprache Jiddisch habe noch ein zweites Problem: »Es wurde über Jahrhunderte unter Juden als Jargon angesehen, und jeder, der etwas auf sich gehalten hat, hat erst einmal den Jargon abgelegt.« Vom Sprachgebrauch und von der Denkweise sei die Welt des Jiddischen einfach nicht so digital wie das Hebräische. Lukac bestätigte damit den Ich-Erzähler Zwi Abel in dem Roman Fojglman (deutsch 1992) des kürzlich verstorbenen Schriftstellers Aharon Megged: »Ich kenne keine zwei Sprachen, die einander so fern sind wie Jiddisch und Hebräisch, als gehörten sie zwei Völkern.«
menschlich Lukac begründete dies wie folgt: »Jiddisch hat nie ein Land gehabt, war immer zu Gast in eines anderen Haus: Da hat man das Zusammenleben entwickelt, die Differenzierungen der Blicke, der Gesten, der Ausdrücke, der Tonfälle.« Bei der jiddischen Lexik falle auf, dass es für Macht, Strategie und Politik, aber auch für die Natur nur wenige Wörter gebe, aber dreimal so viele wie im Deutschen für zwischenmenschliche Beziehungen.
Für viele andere Sprachexperten indes ist Jiddisch keineswegs eine »sterbende Sprache«. Die Publizistin Ursula Homann erklärte 2003: »Versunkene Welten? Das Jiddische hat sein letztes Wort noch nicht gesprochen.« Der Jiddist Jan Schwarz von der Universität Lund hebt in dem Buch Survivers and Exiles: Yiddish Culture After the Holocaust (2015) das nach dem Zweiten Weltkrieg aufblühende Interesse an jiddischer Sprache, Musik, Literatur und darstellender Kunst hervor.
Björn Akstinats Artikel »Lesen in der Mameloshn« im Magazin WINA (2015) urteilt, dass das Interesse an jiddischer Kultur derzeit eine Renaissance erlebe. Die amerikanische Website www.yiddishwit.com, das von Andrea Livnat vielfältig ausgerichtete Portal www.hagalil.com sowie die Vielzahl jiddischer Medien, die die Internationale Medienhilfe IMH auf ihrer Homepage (www.imh-deutschland.de) aufführt, bestätigen das.
»kompaktl« Avraham Novershstern, Direktor des Zentrums Beit Shalom Aleichem in Tel Aviv, der seine kosmopolitisch und multikulturell ausgerichtete Stadt für den perfekten Standort für das Jiddische hält, bestätigt die enorm angewachsene Studentenzahl für Jiddischkurse. Die jungen Teilnehmer scheuen – neben alten vom Jiddischen inspirierten Wörtern wie Kumsitz für Lagerfeuer – auch nicht die Neologismen des Elektronikzeitalters: »shleptop« (Laptop), »internetz« (Internet), »blitzpost« oder »blitzbrif« (E-Mail), »singerei« (Popkonzert), »webart«/»vebzeitl« (Webseite), »haymblat« (Homepage) und »kompaktl« (CD).
Auch an Literatur herrscht kein Mangel: Im Yung Yidish Book Museum, das der Literaturwissenschaftler und Sänger Mendy Cahan 2006 in Räumen des Zentralen Tel Aviver Omnibusbahnhofs gründete, befinden sich bislang 60.000 Bände in jiddischer Sprache; die Räume dienen auch der Kulturinitiative Yung Yidish als Veranstaltungsraum.
Der IMH zählt international 100 Zeitungen und zehn Rundfunkprogramme auf Jiddisch. Schätzungen über die Zahl der Menschen, die heute Jiddisch beherrschen, sind unterschiedlich: Circa vier Millionen dürfte realistisch sein. Das bilinguale Blatt »Der Moment/The Moment« aus Montreal betont, es sei »in authentischem Vorkriegs-Jiddisch abgefasst«. Die Gazetten der orthodoxen Juden in den USA – »Der Blatt«, »Der Yid« und »Di Tzeitung« – haben Auflagen von über 10.000 Exemplaren. Das von der League for Yiddish edierte säkulare Kulturmagazin »Afn Shvel« (Auf der Schwelle) wird von der Chefredakteurin Sheva Zucker betreut, der Autorin des Leitfadens Yiddish: An Introduction to the Language, Literature & Culture.
Rückschläge Aber die jiddische Presse erlitt auch Rückschläge. Das früher zu den maßgeblichen jiddischsprachigen Organen der USA zählende »Algemeiner Journal« wird heute fast gänzlich auf Englisch publiziert. Der New Yorker »Yiddish Vorwaerts«, der in den 20er-Jahren eine Tagesauflage von 250.000 Exemplaren hatte, erscheint als »The Jewish Daily Forward« nur noch wöchentlich in einer englischen und 14-täglich in der jiddischen Internet-Version yiddish.forward.com. Allein in New York, so schätzt ihr Redakteur Itzig Gottesmann, leben heute etwa 200.000 orthodoxe Juden, von denen das Gros zwar Jiddisch sprechen, aber nicht mehr Jiddisch lesen kann.
Dieses Phänomen beleuchtet John McWhorter von der Columbia University in der neuesten Ausgabe des Schweizer Magazins »Monat«: »Das Jiddische wird oft als aussterbend beschrieben, wiewohl tatsächlich Hunderttausende Menschen in den USA und in Israel die Sprache Tag für Tag benutzen und sie ihren Kindern beibringen – eben ohne sie in nennenswertem Maß zu schreiben. Unter den mehreren Hundert Sprachen, die auch in 100 Jahren noch gesprochen werden, sind dann auch höchstwahrscheinlich diverse ›bloß‹ gesprochene Sprachen.«
Yechiel Szeintuch, Lehrstuhlinhaber für Jiddisch an der Hebräischen Universität Jerusalem, vertritt dieselbe Meinung: »Im wissenschaftlichen Sinne ist Jiddisch für absehbare Zeit nicht als eine vom Aussterben bedrohte Sprache zu bezeichnen; es ist eine aktive Sprache literarischen Schaffens und wird in vielen Ländern der Welt gelehrt.«
Interesse Für den deutschsprachigen Raum begrüßt Hanno Loewy, seit 2004 Leiter des Jüdischen Museums Hohenems, »dass in den letzten Jahren das akademische Interesse einer jungen Wissenschaftlergeneration an Jüdischen Studien mit einer breiteren kulturwissenschaftlichen Perspektive zugenommen hat. Dazu gehört auch das Jiddische«.
Bemerkenswert ist auch, dass bei uns in den vergangenen Dekaden sogar eine Reihe von Übersetzungen ins Jiddische erschien: 1999 kam der Struwwelpeter heraus – als Pinye Shtroykop, vitsike mayses un komishe bilder; es folgten Max und Moritz als Shmul un Shmerke, Orwells Farm der Tiere als Der Khayes-Folvark: a Vunder-Mayse, Brechts Dreigroschenoper als Di Drayer Opere und Kishons Oysgeklibene Satires.
Sogar die Werke der Brüder Grimm, darunter deren Kinder- und Hausmärchen (1812), wurden als Oysgeklibene Mayses von Andrea Fiedermutz, der Herausgeberin des Literaturmagazins »Naye Vegn« und Shlomo Lerman (dem wir Saint-Exupérys Der kleyner prints verdanken) vorgelegt – in hebräischer und lateinischer Schrift. Das erleichtert die Lektüre der Geschichten von »Meylekh Droslbord«, »Dornreyzl«, »Rumplshtiltsl«, »Froshkenig oder der ayzerner Heinrich«, »Rapuntsele«, »Di mume Hole«, »Shneyvaysl un Royznroyt«, »Di shterntoler«, »Henzl un Gretl« sowie »Shneyvaysele und Roythaybele«.
kurios Der Salzburger Jiddist Armin Eidherr fragte 2006 kritisch: »Literarische Übersetzungen in das Jiddische im 21. Jahrhundert, wofür und für wen?« und bilanzierte: »Die Übersetzungen sind nicht schlecht, wirken oft aber bemüht und steril. Kishon ›funktioniert‹ noch am besten – genauso wie die Märchen der Brüder Grimm. Es stellt sich die Frage, warum man nicht schon existierende Übersetzungen, philologisch betreut, neu zugänglich macht. Irgendwie wirken die neuen Bücher wie Kuriosa.«
Shmuel Atzmon-Wircer, Gründer des heute bei jungen Israelis hoch geschätzten Yiddishspiel-Theaters, sprach schon 1994 von der »Wiederbelebung einer Sprache, die nie tot war«. Offenbar mit einem Augenzwinkern versah er jedoch die Rätselfrage »Farvoss farmacht der hon die oigen ven er krayt?« (Warum schließt der Hahn die Augen, wenn er kräht?) und die Antwort »Veil er kenn ess off oisenvaynig!« (Weil er es auswendig kann!) mit dem Kommentar: »Frage und Antwort passen recht gut auf den Juden und sein Verhältnis zum Jiddischen. Entweder kennt er es auswendig oder gar nicht. In Wahrheit kennen es die meisten Juden nicht.«
Der Autor ist Sprachwissenschaftler und Professor em. am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Hamburg. Zuletzt erschien von ihm » Gauner, Großkotz, kesse Lola. Deutsch-jiddische Wortgeschichten«. Be.bra, Berlin 2016.