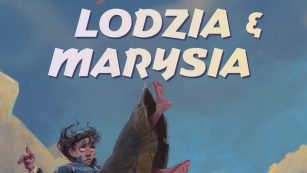Wenn ich zum Thema Frau und Judentum gefragt werde, mache ich zunächst einmal die Gegenprobe auf: Mann und Judentum. In der Encyclopaedia Judaica finde ich dazu: nichts! Man(n) ist Mensch, und so finden sich Beiträge zur Anthropologie, nicht aber zur Stellung des Mannes in der antiken Gesellschaft oder zur Begründung für die spezielle Stellung des Mannes im Gottesdienst.
Das heißt: Wenn im Kontext der jüdischen Religionskultur die Frau thematisiert wird, dann ist sie ein Objekt, während der Mann (oft sogar als das schreibende Subjekt) gar nicht auf die Idee kommt, sich selbst in seiner Männlichkeit zum Thema zu erheben. Und so definiert die Frage nach der Frau im Judentum die Frau als eine spezifische Ausformung des jüdischen Menschen, der daher auch eine eigene Beschreibung zukommt: In der halachischen Bewertung ist die Frau ein Sonderfall.
Neuerungen Dieser Befund steht nun aber in diametralem Gegensatz zu der Tatsache, dass die halachische Stellung der Frau im deutschen Judentum zu dem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal zwischen »orthodox« und »liberal« geworden ist: Fordern Frauen an Simchat Tora für sich ein, dass auch sie die Torarollen tragen dürfen, ist mit erhöhtem Aggressionspotenzial ungewissen Ausgangs zu rechnen.
Da helfen auch keine halachischen Gründe, die solche Neuerungen stützen würden. Auch die Batmizwa-Feier kann in der ein oder anderen Synagoge zu Verwerfungen führen, wenn es darum geht, das Mädchen vielleicht doch stärker in den Gottesdienst einzubinden. Dass Rabbinerinnen nicht unbedingt zu den unangefochtenen Autoritätspersonen gehören, ist in so mancher deutschen Gemeinde Realität, sodass viele Gemeinden schon aus diesem Grund oft lieber einen Rabbiner als eine Rabbinerin berufen.
Unversehens findet sich die Frage nach der halachischen Stellung von Frauen im Zentrum des religiösen Diskurses: Ob jemand einen koscheren Haushalt führt oder den Schabbat hält, ist in der Tat schon lange nicht mehr das Schibbolet zwischen traditionell und reformorientiert. Es kann gut sein, dass jüdische Familien, für die das Kaschrut- und das Schabbatgebot wichtig sind, in einen egalitären Gottesdienst gehen. Und umgekehrt: Wie viele Juden und Jüdinnen gehen in einen traditionellen Minjan, ohne selbst Kasch-rut oder Schabbat zu halten? Da ist die Frage, ob Frauen Tora lesen dürfen oder nicht, einfacher zu beantworten, weil die Kriterien eindeutig sind: Frauen sind Frauen, und Männer sind Männer.
Zankapfel Dass Frauen zum religiösen Zankapfel geworden sind, war nicht immer so: Als das deutsche Judentum im frühen 19. Jahrhundert gottesdienstliche Reformen durchsetzte, war die Frauenfrage noch nicht das unterscheidende Merkmal zwischen Reformern und (Neo-)Orthodoxen. Da ging es um die Liturgie (Hebräisch oder Deutsch), um Inhalt und Umfang der Texte, die gelesen werden sollten, um die Orgel im Gottesdienst, kurz: Es waren noch inhaltlich relevante Fragen, die von der Reformbewegung gänzlich anders als in der Orthodoxie beantwortet wurden. Wieso steht dann aber heute die Frauenfrage so zentral im Raum?
Die Frauenfrage wird im Judentum so lange nicht ad acta gelegt sein, wie sie vor allem im traditionellen Judentum immer wieder an die Oberfläche kommt, denn hier klaffen die gesellschaftliche (nichtjüdische) und religiöse Welt auseinander. Man darf ja nicht vergessen, dass auch das gegenwärtige orthodoxe Judentum in Deutschland kein Judentum des 16. und 17. Jahrhunderts ist, in dem eine bestimmte Geschlechteraufteilung einfach selbstverständlich war und darin auch mit den religiösen Vorschriften kongruent verlief. Heutige orthodoxe Frauen sind gleichermaßen Teil der hiesigen Gesellschaft und von den Verwerfungen zwischen den Geschlechtern der vergangenen Jahrzehnte nicht mehr losgelöst.
Dass auch orthodoxe Frauen längst Hof und Herd verlassen haben, um in qualifizierten Berufen ihr eigenes Geld zu verdienen, während ihre zunehmend kleiner werdende Kinderschar in Ganztagsbetreuung ihren Tag verbringt, ist ja nicht der Ausnahmefall, sondern immer mehr die Regel.
Dass auch die orthodoxe Frau in der Mehrheitsgesellschaft angekommen ist, sieht man etwa daran, dass sie unter der Mehrfachbelastung Beruf, Kinder und Schabbatvorbereitung genauso ächzt wie die nicht-orthodoxe (bei der allenfalls die Schabbatvorbereitung nicht ganz so opulent ausfallen wird). Diese Mehrfachbelastung gehört ja nicht spezifisch zum Judentum, sondern zu der üblichen gesellschaftlichen Lüge, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ganz leicht und mit einem Lächeln zu bewältigen sei, während der Mann wie eh und je seinem Tagwerk nachgeht.
Binnenraum Auch für die Orthodoxie gilt: Den Preis für die moderne Familie zahlen noch immer die Frauen. Umso mehr also ist hier der Diskurs zu führen, warum ausgerechnet im religiösen Binnenraum der Unterschied zur Mehrheitsgesellschaft so markant und für Einzelne durchaus schmerzlich ist, wenn ihnen die gottesdienstliche Teilhabe verwehrt wird und es auch nicht abzusehen ist, wie der religionsgesetzliche Rahmen in nächster Zeit in Schwingung zu bringen wäre. Zumindest innerhalb Deutschlands ist die Diskussion um die halachische Stellung der Frau noch nicht so weit gediehen, dass man neue Zugänge erhoffen könnte.
Lässt man(n) sich also in dieser Hinsicht nur ungern reinreden, so sprechen die Frauen am Besten mal untereinander und vielleicht nicht nur darüber, wie sich die Nachbarin äußerlich zurechtmacht: Langer Rock, Perücke, Tichel? Hose, kurzes Röckchen, offenes Haar?
Da ja schon die (orthodoxen) Männer die jüdischen Frauen nach äußerlichen Merkmalen taxieren, um deren Koscher-Grad zu bemessen, so ist doch zu hoffen, dass wir jüdischen Frauen in den inhaltlichen Diskurs einsteigen, innerhalb und außerhalb des Gottesdienstes: Tora und Talmud statt Tichel und Tratsch! Wir sollten uns nicht die männlichen Diskurse zu eigen machen, weder jene um Äußerlichkeiten noch jene um Macht und Ämter. Setzen wir uns zusammen, um zu erfahren, was sich in den Köpfen der Einzelnen zu einem jüdischen Selbst zusammendenkt. Lernen wir zusammen, damit die verschiedenen Denominationen als Bereicherung verstanden und ihre Grenzen wieder durch inhaltliche Diskurse und nicht halachische Sonderfälle markiert werden.
Die Autorin lehrt Bibel und Jüdische Bibelauslegung an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg (HfJS).
»Frau und jüdisch. Zur Rolle und Bedeutung der Frau im Judentum« – so lautet das neue Seminar der
Bildungsabteilung im Zentralrat der Juden, das vom 18. bis 20. Februar in Frankfurt am Main stattfindet. Neben der Verfasserin dieses Beitrags, Hanna Liss, werden sich dort u.a. Charlotte Elisheva Fonrobert, Adriana Altaras, Rachel Heuberger, Gesa Ederberg, Elisa Klapheck, Sara Soussan, Alina Treiger, Bea Wyler und Ellen Presser mit orthodoxen, konservativen und liberalen Interpretationen der Rolle der Frau im Judentum beschäftigen.
bildungsabteilung@zentralratdjuden.de