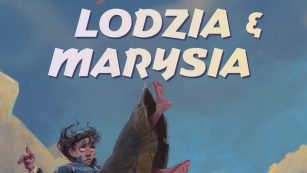Warum wird in Deutschland protestiert, wenn die Union mit der AfD abstimmt, aber geschwiegen, wenn es um Antisemitismus geht?
Diese Frage war eine, die ZDF-Talkmaster Markus Lanz am Mittwochabend seinen beiden Gästen stellte. Die 92-jährige Éva Szepesi, die in Ungarn aufwuchs, das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau überlebte und heute in Frankfurt lebt, und der Journalist und früheren Fußballkommentator Marcel Reif, dessen Vater nur mit viel Glück die Schoa überlebte, waren im Studio zu Gast. Vor einem Jahr hatten Szepesi und Reif im Bundestag anlässlich der Gedenkstunde zum Holocaustgedenktag gesprochen.
»Viele sind gegangen auf die Straße gegen die CDU, gegen Merz. Aber als dann wieder dieser Judenhass kam und Leute riefen ›Wer eine Waffe hat, soll alle Juden totschießen‹, da ist keiner auf die Straße gegangen. Warum ist das so? Warum wird geschwiegen?« fragte Szepesi. »Wo sind die Menschen, die da (zuvor gegen die CDU) draußen waren?«
Marcel Reif, der seine Rede vor einem Jahr mit dem Satz seines Vaters, »Sei ein Mensch«, beendet hatte, kam auf seine Eindrücke von der Gedenkveranstaltung im Parlament zu sprechen. »Alle ziehen dunkle Anzüge an, Plenarsitzung, Streichquartett, man spielt ernste Musik, alle gucken betreten. Anderthalb Stunden, zwei Reden – und danach gehen wir nach Hause.« Ob man so dem Datum 27. Januar gerecht werde?
»Nie wieder muss gelebte, unverrückbare Wirklichkeit sein.«
marcel reif
Was im Bundestag zuletzt passiert sei, so Reif, sei für ihn auch ein Tabubruch. Damit meinte er aber nicht, dass die CDU gemeinsam mit der AfD einen Antrag verabschiedete, sondern die Tatsache, dass die AfD dort so stark vertreten sei. »In diesem Bundestag sitzt eine große Fraktion, die gesichert rechtsgerichtet, in großen Teilen rechtsradikal und in Teilen rassistisch ist.« Ein Tabubruch sei auch, dass seine in Tel Aviv lebende Cousine ihm am Telefon sage, sie mache sich Sorgen um seine Sicherheit, wo doch bei ihr die Raketen der Hisbollah einschlügen.
Reif sagte, wenn man »Nie wieder« ernst meine, dürfe das nicht nur ein Appell sein. »Nie wieder muss gelebte, unverrückbare Wirklichkeit sein«, forderte er. Man müsse man die Wähler »zurückholen in die Mitte«. Ansonsten sei das viel beschworene Postulat »wohlfeil und billig«, so der 75-jährige Schweizer.
Reif ist Sohn einer katholischen Mutter aus Schlesien und eines polnischen Juden. Er betonte auch die besondere Rolle der Zeitzeugen bei der Vermittlung des Wissens. Man müsse verhindern, dass der Holocaust irgendwann ein geschichtliches Datum werde wie das Ende des Römischen Reiches. »Wenn wir das nicht hinkriegen, dann sind all die Gedenkstunden nicht gut und es ist eine Schande und das nächste Verbrechen an dieser Generation (der Überlebenden), die das noch erleben muss.«
Er habe auch Mühe, so Reif, den Judenhass von heute einer bestimmten Richtung zuzuordnen. Früher sei klar gewesen: Antisemitismus, das komme aus der rechtsradikalen Ecke. Heute sei das anders. Mittlerweile müsse man auch »ganz nach links« schauen, wo Kritik an Israel in Antisemitismus ausarte. »Da ist dieser Hass auf Juden und zuweilen fühle ich mich in diesem Land nicht wohl. Denn entweder ich kann Menschen überzeugen, dass das nicht geht und wenn ich das nicht kann.«
Es müsse auch Teil der viel beschworenen deutschen Staatsräson sein, dass Antisemiten »zur Räson« gebracht werden. »Ich kann nicht zulassen, dass eine Universität von Judenhassern besetzt wird und dass, wenn dann die Polizei kommt, weil ein Rechtsbruch vorliegt und das ihr Job ist, die Präsidentin dieser Uni sagen kann, ›Nein, geht weg, wir brauchen euch nicht‹, und jüdische Studenten und Andersmeinende sich nicht mehr frei bewegen können«, so Reif in Anspielung an die jüngsten Vorfälle an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, die von israelfeindlichen Aktivisten besetzt wurde.
So etwas sei nämlich strafbar. Würde er sich heutzutage am Flughafen eine Zigarette anzünden, würde er »zwei Minuten später die Kavallerie« hören und eine Strafe bekommen, sagte Reif. Wenn aber auf deutschen Straßen und Plätzen eindeutig strafbare Parolen in Richtung Polizei gebrüllt würden, hieße es am nächsten Tag nur lapidar, man könne die Betreffenden nicht eindeutig identifizieren.
»Ich habe wirklich Angst, wie das weitergehen wird.«
Éva szepesi
»Wir sind längst über die Anfänge hinaus«, so der Journalist. Er höre zwar immer den Satz »Es muss Platz geben für jüdisches Leben« und das sei ja auch wohlmeinend gesagt. Aber es werde eben nicht dafür gesorgt, dass ein Jude ganz normal leben könne in Deutschland. »Zweimal die Woche bin ich in Berlin und fahre am Jüdischen Museum vorbei. Du denkst, da drin sei ein Hochsicherheitstrakt.«
Auch Éva Szepesi pflichtete ihm bei: »Ich habe wirklich Angst, wie das weitergehen wird.« Wenn sie an Schulen auftrete, habe sie gelegentlich Polizeischutz. Das Gefühl einer wachsenden Bedrohung für Juden in Deutschland sei eindeutig gewachsen, vor allem seit den Hamas-Massakern vom 7. Oktober 2023. Gleichzeitig habe ihre in Israel lebende Enkelin mehr Angst um sie als um sich selbst.
Die aus Ungarn stammende Szepesi war 1944 zu Fuß in die Slowakei geflüchtet, wurde dort aber von den Nationalsozialisten entdeckt, in ein Sammellager gebracht und im November 1944 nach Auschwitz deportiert. Dort hatte sie Glück: Am Tag ihrer Ankunft fanden keinen Selektionen statt.
Stattdessen sagte ihr eine Aufseherin, sie solle sich als 16-Jährige ausgeben, um der Gaskammer zu entgehen und zum Arbeitsdienst zugewiesen zu werden. Szepesi überlebte als eines der wenigen Kinder das Vernichtungslager und wurde am 27. Januar 1945 dort befreit. Ihre Eltern und ihr Bruder waren schon im Sommer 1944 nach Auschwitz deportiert worden und überlebten nicht.
Was sein werde, wenn Szepesi ihre Geschichte und Reif die seines Vaters nicht mehr erzählen können, wollte Markus Lanz von seinen Gästen wissen. Reifs Antwort: »Ich kann das, was mir mein Vater mitgegeben hat, weitererzählen. Seine Geschichte muss ich weitertragen.« Erinnern sei zwar gut, aber man müsse auch etwas gegen das sagen, was heute passiere. »Sonst ist nie wieder nie wieder.«
Und auch Éva Szepesi will weitermachen und junge Leute direkt ansprechen. Sie begleitet auch Besuchergruppen zu den Gedenkstätten. Am Mittwoch gab die Jüdische Gemeinde Frankfurt bekannt, dass die 92-Jährige das silberne Ehrensiegel für ihren Einsatz erhalten soll, die höchste Auszeichnung, die die Gemeinde vergibt.