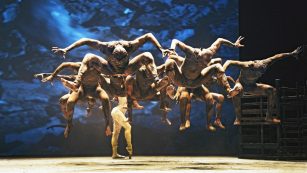Igor Levit brodelt auf zwei unterschiedliche Arten. Wenn er Musik macht, brodelt er hauptsächlich nach innen. Als politischer Mensch, der seine Meinung zum Zeitgeschehen formuliert, brodelt er nach außen. Dann kocht seine Wut in allen Foren, auf Facebook oder auf Twitter. Er tobt über das »rassistische Dreckspack«, wenn in Berlin auf ausländische Kinder uriniert wird und fasst seine Bestandsaufnahme für Deutschland so zusammen: »Sachsen, überall Sachsen!«
Neulich hat Levit folgenden Satz von einem Kollegen gelesen: »Ein Musiker sollte sich nicht über Politik äußern.« So etwas macht ihn wütend. »Musik ohne politische Positionierung funktioniert nicht. Da könnte ich die Wände hochlaufen! Das ist ein Widerspruch.«
Jahrhundertpianist Igor Levit wurde 1987 in Gorki geboren, bekam Klavierunterricht von seiner Mutter Elena. 1995 übersiedelte die jüdische Familie nach Hannover, und Levit studierte an der dortigen Hochschule und am Mozarteum in Salzburg. Heute ist er einer der spannendsten jungen Pianisten, der von vielen Kritikern gar als Jahrhundertpianist bezeichnet wird. Auch deshalb, weil er das Brodeln über die Welt und das Brodeln in den Klängen von Beethoven oder Bach für untrennbar hält, was er bei seiner mit Spannung erwarteten neuen großen Tournee Anfang September einmal mehr unter Beweis stellen wird.
Vor seinem Konzert jüngst in Bremen wollte er mit den Journalisten nicht über Musik reden, sondern über Pegida. Und wieder kochte er: Politiker müssten sich distanzieren, Bürger aufbegehren, die Hetzer müssten dingfest gemacht werden. Levit redet in Ausrufezeichen. Als er dann auf die Bühne ging, stellte er sich vor den Flügel, drückte die Partitur mit einem Arm an seinen dünnen Körper, schaute sein Publikum eindringlich an und rückte die runde Brille zurecht. Dann erzählte er, was er nun vorhatte: »Ich will Sie mit der Musik, die Sie gleich hören, zwingen, Position zu beziehen.« Levit erklärte Aufbau und Struktur von Frederic Rzewskis Klaviervariationen »People united«.
Rzewski ist US-Bürger und war in den 60er-Jahren sozialistischer Politprovokateur. »People united« besteht aus sechs Mal sechs Variationen des chilenischen Kampfliedes »El pueblo unido«, eines Protestsongs aus der Allende-Ära gegen das US-Handelsembargo. Bevor Levit anfing zu spielen, unternahm er noch einen Exkurs in die Gegenwart. »Das Attentat in Paris, die unsägliche Pegida-Bewegung und selbst die CIA, das dürfen wir nicht vergessen, die war schon am Putsch Pinochets gegen Allende beteiligt. Also, positionieren Sie sich!«
Spannungsgeladen Danach fingert er wieder an seiner Brille herum und setzt sich an das Klavier. »El pueblo unido« dauert weit über eine Stunde. Levit scheint in dieser Zeit in das Instrument zu kriechen. Er hämmert und streichelt, flötet und schnaubt. Er ist nicht mehr in dieser Welt, sondern transformiert die Welt in Klang. Wenn er in der Musik brodelt, kocht er nach innen – und das hört sich fast noch wütender an, als wenn er in Worten brodelt. Spannungsgeladener kann man nicht musizieren.
Igor Levit ist ein moderner Musiker. Einer, der das Klavierspiel als Botschaft begreift, aber auch andere Möglichkeiten sucht, um sich auszudrücken. Er ist ein Medien-Junkie, verschlingt Zeitungen, DVDs und Bücher und sucht gern die Nähe zum Feuilleton: Maxim Biller und Claudius Seidl von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gehören zu seinen Freunden, er reibt sich an Henryk M. Broder und Matthias Matussek. Mit ihnen tauscht er sich aus, mit ihnen streitet er – und sie hören ihm zu.
Tatsächlich gelingt es Levit in seinen Konzerten, dass etwas im Zuschauerraum passiert. Rzewski ist kein Reißer-Programm, aber das Bremer Publikum hört Levit gebannt zu. »Vielleicht liegt es daran, dass ich in jedem Konzert erkläre, warum ich gerade dieses Stück an diesem Ort in dieser Zeit spiele. Weil es mir um den Gegenwartskern der Musik geht. Man darf nicht vergessen, dass jede Musik immer im Heute spielt.«
Klassenkampf Am Ende seines Bremer Konzertes bleibt es still. Levit hat das Thema von »El pueblo unido« in alle Einzelteile zerlegt und wieder zusammengebaut. Nach einer kurzen Pause erhebt sich sein Publikum zu Standing Ovations. Aber das ist nicht immer so. Einige Monate vorher, in Wien, war die Stimmung gespannter. Es lag ein Hauch von Klassenkampf in der Luft.
Nach dem Konzert wurde Levit von einem Zuhörer gefragt: »Wenn Sie so einen Kommunisten spielen, warum spielen Sie nicht auch das Horst-Wessel-Lied?« Der Pianist verstand die Frage als Affront. »Ich hätte dem Typen am liebsten eine reingehauen«, sagt Levit. Aber dann antwortete er: »Mit Verlaub, die Nazis haben keine gute Musik geschrieben – zeigen Sie mir ein gutes Werk, und ich werde es spielen.«
www.igor-levit.de