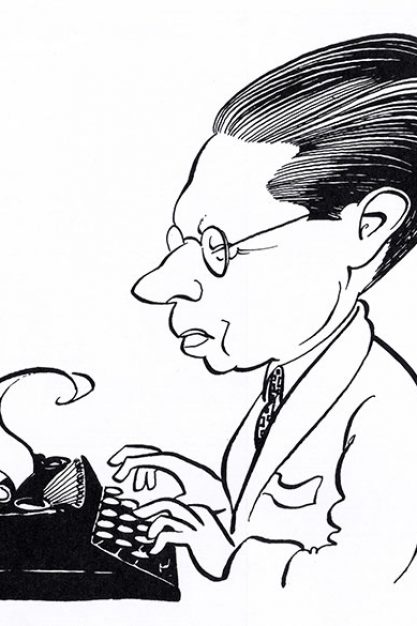Im Februar 2010 stellte Leser Siegfried Arnold in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Marcel Reich-Ranicki folgende Frage: »Lassen Sie uns etwas über Lion Feuchtwanger wissen«, um eine erstaunlich positive Antwort zu erhalten: »Er liebte klare Linien und grelle Farben ... Wie die meisten Romanciers dieser ... Generation war auch Feuchtwanger sein Leben lang von der Psychologie beeindruckt. Ob Künstler oder Geistliche, Politiker oder Geschäftsleute ... sie bewunderten immer das gleiche Temperament. ... Was sie auch tun mögen – sie erweisen sich als ehrgeizige Intellektuelle zwischen den Fronten.«
josephus-trilogie Bei alledem erwähnt Reich-Ranicki die Josephus-Trilogie mit keinem Wort. Womöglich war es ihm unangenehm, darauf hinzuweisen, dass Feuchtwanger ein bedeutendes Werk über einen jüdischen Intellektuellen verfasst hatte, über den griechisch schreibenden Autor Flavius Josephus, der als junger Mann Offizier im judäischen Aufstand gegen die Römer war, um dann zum Hofhistoriker des flavischen Kaiserhauses zu werden, das die Zerstörung des Tempels zu Jerusalem zu verantworten hatte und damit Platz für das rabbinische Judentum schuf.
In einer Nachbemerkung zum im Ost-Berliner Aufbau Verlag erschienenen zweiten Band der Trilogie vermerkt Feuchtwanger: »Der Roman Josephus sollte ursprünglich nur zwei Teile umfassen ... Als aber im März 1933 die Nationalsozialisten mein Haus in Berlin plünderten, vernichteten sie das ausgeführte Manuskript dieses Schlussbandes, sowie das vorhandene wissenschaftliche Material. ... Ich hatte zu dem Thema des Josephus: Nationalismus und Weltbürgertum manches zugelernt, der Stoff sprengte den früheren Rahmen, und ich war gezwungen, ihn in drei Bände aufzuteilen.«
umfrage Feuchtwangers Josephus-Trilogie könnte mit Blick auf jüdische Selbstfindung im Zeitalter des Ende des Nationalstaats und der Globalisierung von großer Aktualität sein – ähnelt doch das Römische Reich der Antike in religiöser, kultureller und teilweise auch politischer Hinsicht frappierend der globalisierten Welt von heute.
Auch die persönlichen und politischen Probleme, mit denen die jüdischen Protagonisten der Trilogie zu kämpfen haben, sind die heutiger Jüdinnen und Juden. Dazu einige Beispiele aus dem jüngst erschienenen »Pew-Report« zur Lage der amerikanischen Juden: Demnach meinen 62 Prozent der Befragten, dass ihr Judentum wesentlich eine Angelegenheit von Herkunft und Kultur sei. Bedeutsam ist weiterhin, dass die Zahl interkonfessioneller Ehen in den letzten 20 Jahren von 41 auf 58 Prozent gestiegen ist. Für die Beziehung zum Staat Israel gilt: Jeweils mehr als 70 Prozent geben zu Protokoll, dem Staat Israel sehr stark oder doch irgendwie verbunden zu sein.
Fragt man nach dem Kern jüdischer Identität, so geben 73 Prozent das Gedenken an den Holocaust zur Antwort, 69 Prozent sehen diesen Kern in einem ethischen Lebenswandel, während weitere 56 Prozent reklamieren, Jüdischsein bedeute, für Gerechtigkeit und Gleichheit einzutreten. 25 Prozent sehen den Kern jüdischer Identität in der Sorge um Israel.
All dies schlägt sich in der paradoxen Sorge der amerikanischen Juden um den Staat Israel nieder. Beispielhaft etwa bei dem Politologen Peter Beinart, einem modern-orthodoxen Juden, der mit einem Buch über die amerikanischen Juden und Israel Zustimmung, aber auch wütenden Widerspruch geerntet hat. Feuchtwanger hatte zu Protokoll gegeben, der thematische Kern seiner Trilogie sei die Spannung zwischen Nationalismus und Weltbürgertum. Wenig anders hört sich das Bekenntnis von Peter Beinart an: »Ein liberal denkender Jude, dem es gleichgültig ist, ob der jüdische Staat eine Demokratie bleibt«, so Beinart, »versündigt sich ebenso sehr gegen sein Volk wie ein Jude, dem es gleichgültig ist, ob dieser Staat überhaupt überlebt.«
zionismus Reich-Ranicki hatte Feuchtwanger und seine Helden als »ehrgeizige Intellektuelle zwischen Fronten« charakterisiert. Und tatsächlich stand der Josephus des Lion Feuchtwanger zwischen den Fronten: mal nüchterner Realpolitiker, der einsehen musste, dass militärischer Widerstand gegen die römische Übermacht sinnlos war, dann Kosmopolit, der darum kämpfte, dass die römische Kultur das universalistisch-prophetische Judentum ebenso übernehmen sollte wie die Kultur der griechischen Antike, dann aber auch ein einzelner jüdischer Mann – vom Antisemitismus ebenso betroffen wie von seinen missglückten Beziehungen zu nichtjüdischen Frauen.
Am Ende der Trilogie, hochbetagt, begibt sich Josephus – das ist Feuchtwangers freie Erfindung – noch einmal nach Judäa, nimmt Kontakt zu antirömischen Aufständischen auf, um von einer römischen Patrouille zu Tode gehetzt zu werden. Der 1940 abgeschlossene Teil der Trilogie gibt jenen eine Stimme, die Feuchtwanger als »Nationalisten« bezeichnet, Personen, die ihm von seiner ganzen Herkunft so fern wie überhaupt nur möglich standen.
In einer gut königlich-bayrischen, neoorthodox-jüdischen Familie groß geworden, die schon mal nach dem Schabbatgottesdienst im Hofbräuhaus ein erstes Bier –selbstverständlich vor Schabbat bezahlt – zu sich nahm, war dem Schriftsteller die jüdische Nationalbewegung, der Zionismus, fremd. Feuchtwanger stilisiert zwei Wege jüdischer Existenz nach der Zerstörung des Tempels: den Weg des Jochanan Ben Sakkai, der den untergegangenen jüdischen Staat durch einen geistigen Staat ersetzen wollte, sowie den Weg der Rächer Israels, die den judäischen Staat durch Krieg gegen die Römer auferstehen lassen wollten. Ihr Sprachrohr war Rabbi Akiba, der gegen die Warnungen seiner rabbinischen Kollegen um 130 den Messiasprätendenten Simon Bar Kochba unterstützte, von den Römern gefangen und zu Tode gefoltert wurde.
rabbi akiba Feuchtwanger lässt seinen Josephus im Jahr 110 Rabbi Akiba treffen. Akiba, im Roman Akawja, weiß die intellektuellen Fähigkeiten des Josephus zu schätzen, kritisiert ihn aber aufs Schärfste, und man mag sich fragen, ob das als Selbstkritik Feuchtwangers zu lesen ist: »Sie machen lieber die Augen zu und ›kämpfen‹ für ein Ideal, von dem Sie ganz genau wissen, dass es unerreichbar ist. ... Sie verraten den Messias von Fleisch und Blut ... um eines verblasenen, geistigen Messias wegen. Sie verraten«, so der Höhepunkt von Akawjas Schelte, »den jüdischen Staat einer kosmopolitischen Utopie zuliebe.«
Nun könnte man meinen, dass es dabei um das zionistische Staatsgründungsprojekt geht, indes: Wer sich in der Geschichte der kommunistischen Bewegung auskennt, weiß, dass zur Zeit der Abfassung des Romans eine strukturell identische Debatte unter kommunistischen Intellektuellen tobte, freilich mit Bezug auf Stalins Sowjetunion und das Programm des »Sozialismus in einem Lande«.
Feuchtwanger war von der damit verbundenen totalitären Versuchung nicht frei. Im Dezember 1936 brach er von Frankreich aus in die Sowjetunion auf, traf dort Stalin, um später einen Reisebericht unter dem Titel Moskau 1937 zu publizieren, in dem er den Personenkult und die Bevormundung der Künstler bemängelte, als Beobachter der Schauprozesse jedoch von der Schuld der Angeklagten überzeugt war.
War also der Akawja des dritten Bandes der Josephus-Trilogie ein Zionist oder ein Verfechter des »Sozialismus in einem Lande«? Akawja hält dem skeptischen Joseph entgegen: »Gesetze und Gebräuche sind gut und Gott wohlgefällig, aber sie bleiben Geschwätz, wenn sie nicht die Vorbereitung sind eines selbstständigen Staates mit Polizei und Soldaten und souveräner Gerichtsbarkeit. Helfen kann uns nur die Wiedererrichtung des Tempels, des wirklichen aus Quadern und Gold ...« Das ist nicht mehr »Sozialismus in einem Lande« sondern – in prophetischer Vorwegnahme – das Programm der nationalreligiösen, rechtsradikalen jüdischen Siedler im Westjordanland, des »Gusch Emunim«.
zerrissenheit Mir ist die Entstehungsgeschichte des letzten Bandes der Trilogie, an dem Feuchtwanger nach dem Hitler-Stalin-Pakt zu arbeiten begonnen hat, nicht in allen Einzelheiten bekannt. Gleichwohl drängt sich der Eindruck auf, dass durch die Charaktermaske des römischen Kaisers Domitian die Gestalt Josef Stalins hindurchscheint: Auch sympathisierende Intellektuelle konnten auf nichts bauen! Domitian versucht, Josephus davon zu überzeugen, dass es für das Reich günstig sei, wenn die Judäer sich erneut empörten.
Josephus erkennt den Blutzoll und widerspricht, um vom Kaiser zu hören: »›Nimm dich in Acht, mein Jude! ... bleib dir bewusst, dass wir ein Aug auf dir halten.‹ Josef war kein furchtsamer Mann, dennoch zitterten ihm die Glieder ... und der Gaumen war ihm trocken.« Feuchtwanger wusste wie sein Freund Brecht, warum er nicht in der Sowjetunion blieb, sondern in die USA ging, die ihm zwar Asyl gewährten, ihm seiner kommunistischen Sympathien wegen jedoch die Einbürgerung verweigerten.
Die totalitäre Versuchung ist nach den Erfahrungen des »Jahrhunderts der Extreme« geringer geworden – Jüdinnen und Juden jedoch, zumal jüdische Intellektuelle, laborieren nach wie vor an jener Zerrissenheit, die Feuchtwanger in seiner Trilogie so genau beschreibt und scharfsinnig analysiert. Damit ist er unser Zeitgenosse – im Zeitalter der Globalisierung hier und eines hochgerüsteten, seine Zukunft verdrängenden jüdischen Staates dort.
Lion Feuchtwanger wurde 1894 in München als Sohn einer Unternehmerfamilie geboren. In der Weimarer Republik gehörte er mit historischen Romanen wie »Jud Süß« und »Die hässliche Herzogin Margarete Maultasch« zu den meistgelesenen deutschsprachigen Autoren. 1932 erschien der erste Band seiner Josephus-Trilogie. 1933 emigrierte Feuchtwanger nach Frankreich, wo er den zweiten und dritten Band des Zyklus schrieb. Nach der deutschen Besetzung des Landes gelang ihm 1941 die Flucht über Spanien und Portugal in die USA, wo er sich in Kalifornien niederließ. Nach dem Krieg als Sympathisant der Kommunisten verdächtigt, gelang es ihm mit Romanen wie »Die Jüdin von Toledo« nicht mehr, an seine früheren literarischen Erfolge anzuknüpfen. Lion Feuchtwanger starb vor 55 Jahren, am 21. Dezember 1958, in Los Angeles an den Folgen einer Krebserkrankung.