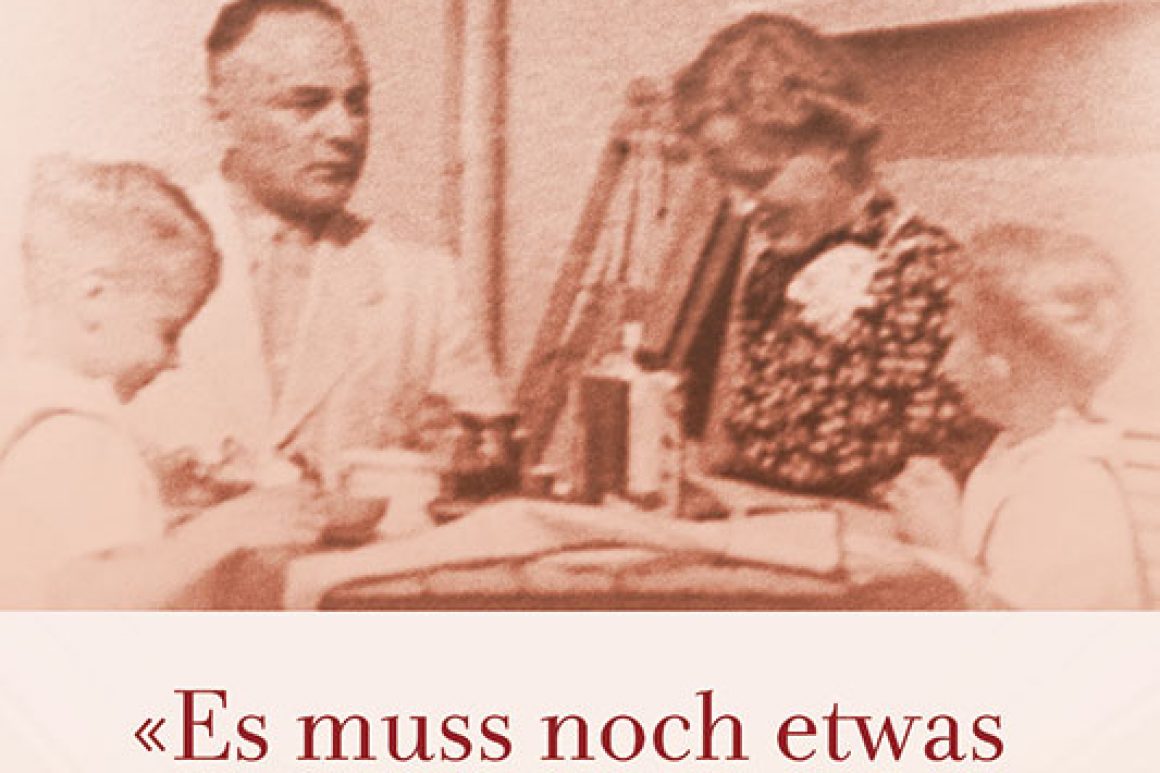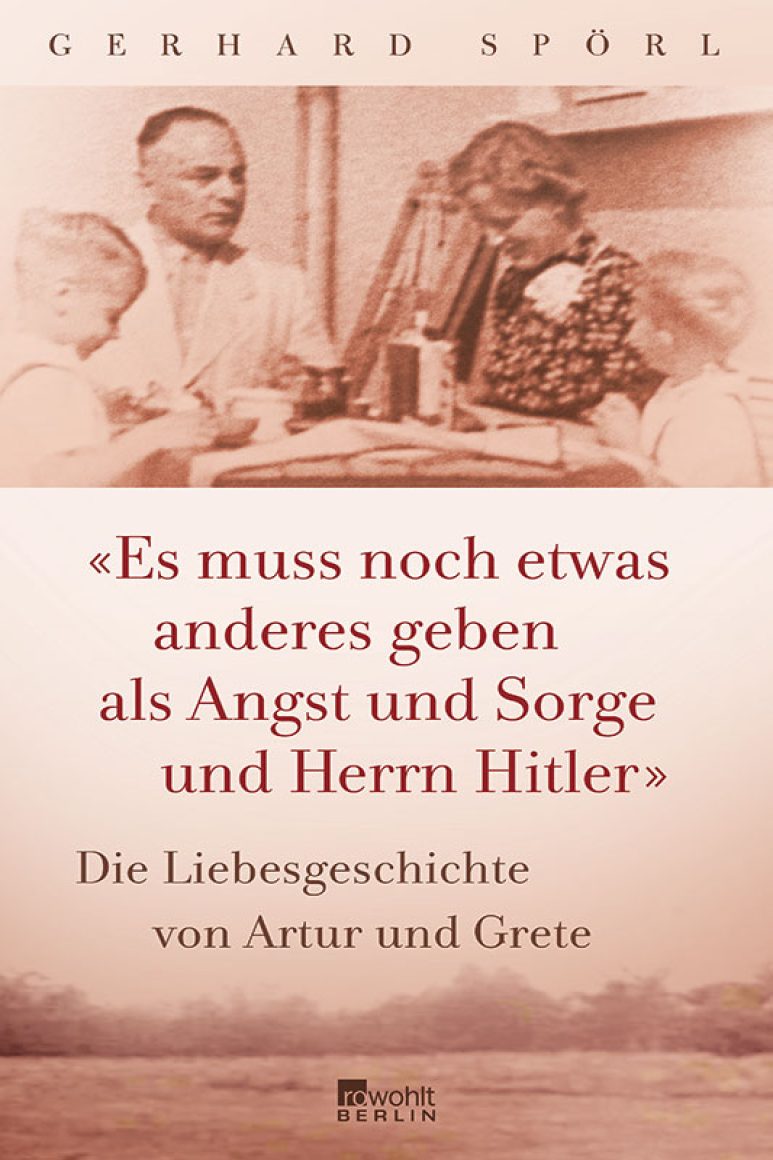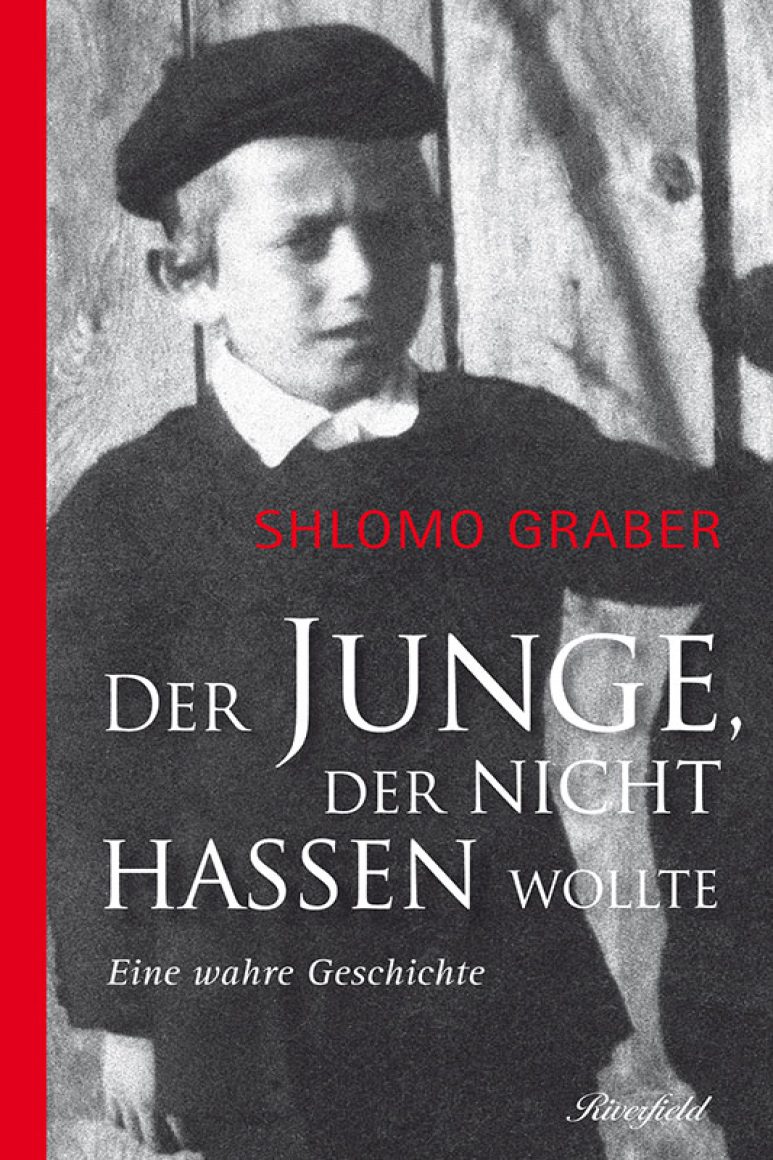Was fasziniert eine schöne junge Frau aus bestem Hause an einem 16 Jahre älteren Mann, der Fahrstunden gibt und Automobile verkauft? Es ist eine Geschichte von Zuversicht und Liebe, Optimismus und Menschlichkeit, die der ehemalige Spiegel-Korrespondent Gerhard Spörl aus der Familie seiner Frau erzählt. Grete liebt Artur, und wer ihrer Liebe durch die bewegten Zeiten folgt, begreift, warum die wohlhabende Kaufmannstochter den Krach mit der Familie, den Bruch mit dem Vater und die Streichung ihres Namens aus dem Testament in Kauf nimmt.
Denn Artur Schlesinger ist ein wunderbarer Mensch: zuverlässig, mutig, beschützend, handwerklich geschickt, vor allem aber optimistisch und immer zielorientiert bei der Lösung eines Problems.
Nazideutschland Sein eigenes Problem ist allerdings ein großes in Nazideutschland: Artur ist Jude. Verheiratet seit 1932 mit Grete, einer Christin. Artur verliert zunächst seinen Job, die Handelsvertretung der Adler-Automobile, und gesteht Grete bei ihrem gemeinsamen Gesprächsritual, dem Abendhalten, dass er in Zukunft als freier Erfinder arbeiten möchte.
»Hinterher denkt er, wie seltsam dieses Abendhalten verlaufen ist. Er hat von seiner Angst erzählt, aber Grete, seine Grete, hat fabelhaft reagiert. Als wäre es das Natürlichste der Welt, hat sie ihm zugestanden, dass er das Kinderzimmer als Werkstatt nutzen darf. Und dann hat sich das Abendhalten weit weg von Hitler entwickelt, und sie haben über ihre mögliche Zukunft als Eltern geredet, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt als die Frage, was ein Kind für eine kleine Familie bedeutet.«
Grete und Artur bekommen zwei Söhne, sie lieben die Gesellschaft von Freunden wie dem Kabarettisten Werner Fink oder dem Schriftsteller Paul Mühsam. Nach der Pogromnacht holt die Gestapo Artur ab; der Zwangsname »Israel« fehlt in seinem Pass. Vier Wochen im Kerker, Grete löst ihn für 1000 Reichsmark aus. Artur ist als Mann einer Nichtjüdin vor der Deportation geschützt. Seine Mutter behauptet, er sei die Frucht der Liaison mit einem verstorbenen Christen, eine in der Nazizeit häufiger genutzte Lüge, mit der Mütter ihre Kinder absichern wollten.
theresienstadt Artur baut in Görlitz ein Haus für seine Familie, meldet als Erfinder Patente an. Schuldgefühle beuteln ihn, denn seine Mutter kommt in Theresienstadt um. Grete, Artur und die Kinder jedoch überleben. Artur wird Mitbegründer der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands, später sächsischer Gesundheitsminister, bevor die SED die Länderregierungen auflöst.
Der Titel klingt sperrig, aber er trifft den Kern: Es muss noch etwas anderes geben als Angst und Sorge und Herrn Hitler. Der besondere Charme der Geschichte: Gerhard Spörl erzählt über den Großvater seiner Frau, Artur Schlesinger. Und Patricia Schlesinger, die Enkelin und heutige Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, berichtet aus ihrer Perspektive, wie sie Grete und Artur als kleines Mädchen noch erleben konnte. »Die Enkelin greift ein«, »Die Enkelin mischt sich ein«, so heißen die Überschriften mit ihren Gedanken zu den Großeltern. Im literarischen Duett der Enkelin mit dem Autor, ihrem Mann, entfaltet sich ein eigener Zauber an Zweisamkeit.
Shlomo Graber war, so der Titel seiner erschütternden Lebensgeschichte, Der Junge, der nicht hassen wollte. Behütet aufgewachsen bei seinem Großvater und seiner Mutter mit drei Geschwistern in einer ungarischen Stadt, bricht das Unglück über seine Familie herein, als die Deutschen Hunderttausende ungarische Juden nach Auschwitz deportieren.
rampe An der Rampe des Vernichtungslagers sieht er seine Familie zum letzten Mal. »Ich konnte gerade noch einen Blick auf Mutter erhaschen. Ihr Haar leuchtete glänzend in der hellen Sonne. Sie hielt meinen jüngsten Bruder Levy auf den Armen, dessen Gesicht mit seinen großen, erstaunt blickenden Augen ich noch einen winzigen Augenblick lang sehen konnte. Die übrigen drei Kinder und Großmutter liefen, sich an den Händen haltend, Mutter hinterher. Dieses Bild hat sich tief in mein Gedächtnis eingeprägt. Bis heute quält mich die Tatsache, dass ich nicht von ihnen Abschied nehmen konnte.«
Graber überlebt mit seinem Vater Auschwitz, zwei weitere Lager und den Todesmarsch, der ihn nach Görlitz führt, wo er das Ende des Krieges und der Judenvernichtung erlebt. Die letzten Worte seiner Mutter hatten gelautet: »Lass keinen Hass in dein Herz. Liebe ist stärker als Hass, mein Sohn, vergiss das nie.« Graber hat sich daran gehalten. In Görlitz herrschte nach dem Krieg Hunger. Er trifft eine junge Deutsche mit einem kleinen Kind, so alt wie seine Schwester Lilly, als die Deutschen sie vergasten. Der 18-jährige Graber geht auf sie zu und schenkt dem Kind ein Stück Brot. Diese Geste hat sein zukünftiges Leben bestimmt, er konnte und wollte nicht hassen.
In der Liebesgeschichte von Artur und Grete berührt der Sieg der Liebe über politischen Terror. In der verzeihenden Regung von Shlomo Graber entfaltet sich ein Kosmos von Menschlichkeit, den die Nazitäter nie kannten. Beides sind wunderbare und ermutigende Bücher.
Gerhard Spörl: »Es muss noch etwas anderes geben als Angst und Sorge und Herrn Hitler«. Rowohlt Berlin 2016, 336 S., 19,95 €
Shlomo Graber: »Der Junge, der nicht hassen wollte«. Riverfield, Basel 2016, 224 S., 19,90 €