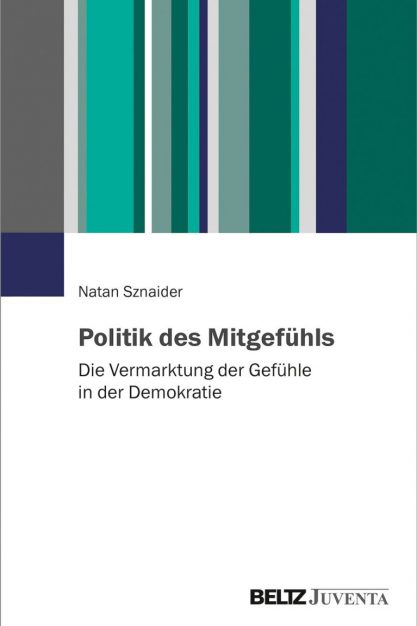Die Thesen und Argumentationsketten sind so attraktiv wie bestechend. Haben etwas Positives. Machen mit Blick auf die Zukunft Hoffnung und setzen im Gegensatz zur allgegenwärtigen Kapitalismuskritik auf Kontinuität. Wir können uns kurz zurücklehnen, durchatmen und dann weitermachen.
Ein kapitalistisches System, angekoppelt an demokratische Prozesse, weiß also auch Emotionalität zu vermarkten, produziert Mitgefühl als stehende wie wachsende Größe, was der Formel »Nie wieder« zu Glaubwürdigkeit verhilft.
Arenen Und natürlich hat Natan Sznaider recht. Wir sind über die Jahrhunderte hinweg auf eine Art mitfühlender geworden. Wir treffen uns nicht mehr mit Kind und Kegel zu blutigen Kämpfen in den Arenen, ebenso wenig wie zur nächsten Hinrichtung auf dem Marktplatz, haben sogar etwas gegen Stier- oder Hahnenkämpfe. Und wir empören und erregen uns, wenn uns Bilder erreichen, auf denen es um die Dokumentation brutaler Gewalt auch am anderen Ende der Welt geht.
Ein Foto von der Leiche eines kleinen Jungen, den Wellen an den Strand geworfen haben, trifft uns mitten ins Herz, öffnet die Augen für die Dringlichkeit, sich mit Menschen, die aus ihrem Land flüchten, zu beschäftigen und sich ihrer anzunehmen. Und diese Berührung hat (manchmal) Folgen, kann etwas bewirken. Die Worte George Perry Floyds »I can’t breathe«, das Knie in dessen Nacken, sind zu einem Auftrag geworden.
Der 1954 in Deutschland geborene Natan Sznaider, der in den 70er-Jahren nach Israel gegangen ist, ist Soziologe, Autor, Kommentator (auch dieser Zeitung), ist mit seinen so klaren wie interessanten Ansichten ein wunderbarer Interviewpartner. Heute lehrt er am Academic College of Tel Aviv. Mit dem Thema Mitgefühl innerhalb des politischen, sozialen und wirtschaftlichen Gefüges beschäftigt er sich schon lange.
Promotion An der New Yorker Columbia-Universität hatte er in den 90er-Jahren über die »Sozialgeschichte von Mitleid« promoviert, 2000 lautete ein Buchtitel von ihm Über das Mitleid im Kapitalismus. Und nun also der Essay Politik des Mitgefühls. Die Vermarktung der Gefühle in der Demokratie. In ihm unterscheidet Sznaider zwischen (subjektivem) Mitleid und (öffentlichem) Mitgefühl; hier gehe es ihm »um Mitgefühl und nicht um Mitleid«, welches sich sehr eng zum kapitalistischen System führen lasse.
Denn: Zur Moderne wie zum kapitalistischen Wirtschaftssystem gehöre immanent die »Entfremdung«, die wiederum, nach Sznaider, Mitgefühl generiere. »Die Revolution der Gefühle entstand im anglosächsischen Raum … Diese Revolution in der Gefühlswelt moderner Menschen ist der kapitalistischen Ordnung geschuldet …«
Auf die Fähigkeit, mit dem anderen mitfühlen zu können, hat das kapitalistische System also sowohl durch seine herbeigeführten Verhältnisse Einfluss – Stichwort Globalisierung, Öffnung zu fremden Welten … – als auch durch seine adaptierbaren, kybernetischen Prozesse, sodass sich am Ende von einer mehrheitlich getragenen Gefühlslage sprechen lässt, die Chancen hat, sich durchzusetzen. (Da setzt Sznaider, ähnlich wie Martha C. Nussbaum, sehr auf die Mittelschicht.)
Sznaider sieht sich nicht als Entdecker dieser Kapitalismusanalyse, er schreibt sie fort und erweist der Tradition der »Denker des anglosächsischen Liberalismus« seine Reverenz, die er im Vergleich zu kritischen Köpfen wie Hannah Arendt, Michel Foucault oder Theodor W. Adorno (sie wirken in seinem Buch ein wenig wie ständig missgelaunte Spielverderber) im Diskurs als bisher etwas vernachlässigt ansieht.
Mitgefühl Und welche Worte findet Sznaider in seiner kleinen Erfolgsgeschichte des Mitgefühls in der Moderne für die Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts, für die Schoa, für die Jahre, in denen jedwedes Mitgefühl abhandengekommen zu sein scheint, in denen von einem vormals halbwegs zivilisierten, kapitalistisch organisierten Deutschland Juden systematisch ermordet wurden? Sznaider sieht in der Schoa einen Bruch im Sinne einer Unterbrechung, eine »Ausnahme von der Moderne«, einen Rückfall in die Vormoderne. »Es ging um die Ausmerzung der Moderne in Verkörperung der Juden«, schreibt er. Kontinuitäten, die in die Jahre nach 1933 geführt haben, stehen außerhalb seiner Betrachtungen, ebenso wie Kontinuitäten nach 1945.
»Wir müssen imstande sein, mitzufühlen, wenn wir verlangen, dass etwas nie wieder geschehen soll. … Das Nie wieder braucht eine Konzeptualisierung und Definition des Wieder«, schreibt er als Warnung an die Moderne (und dazu könnte man dann doch wieder Herbert Marcuse lesen und zum Verdacht, dass es sich bei aller Gewaltdistanz auch um Sublimierung oder bloßes Unter-Verschluss-Halten handeln könnte, dann auch noch Michel Foucault). Der Ausdruck der »Ausnahme« suggeriert eine fast natürliche Rückkehr zur »Regel«.
Auch wenn er, wie hier bei Sznaider, der Beschreibung unter einem ganz speziellen Aspekt dient. In einem ersten Verständnis könnte sich dabei eine Art »Gelegenheit« auftun, beim Blick auf die nahe Vergangenheit der Sehnsucht nach erwünschter, durchgängiger Kontinuität nachzukommen, die dem wichtigen Bewusstsein für den »dünnen Firnis der Zivilisation« sehr entgegensteht.
Natan Sznaiders Buch lädt, auch wegen seines unaufgeregten, fast mündlichen Stils, zur Diskussion ein. In manche These möchte man unbedingt tiefer einsteigen. Und manche Sätze möchte man öffentlich bejubeln. Katrin Diehl
Natan Sznaider: »Politik des Mitgefühls. Die Vermarktung der Gefühle in der Demokratie«. Beltz, Weinheim 2021, 196 S., 16,95 €