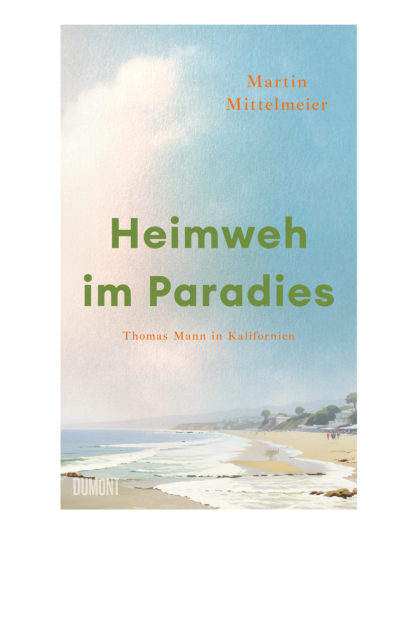»Wo er ist, da ist Deutschland«: Davon war Thomas Mann überzeugt. Auch in Amerika – von dort kehrte der Schriftsteller 1938 nach einer Vortragsreise nicht mehr in sein Schweizer Exil zurück. »Wichtig ist ihm der diskrete Luxus, das hergerichtete und umgehend wieder abgeräumte Frühstück, dass er keine Zeit und keine mentalen Kapazitäten für unerquickliche Verrichtungen verliert. Wenn das gewährleistet ist, dann ist es eigentlich wie überall: Tisch, Sessel, Lampe, Bücherreihe, Thomas Mann. Zu hause ist, wo er schreiben kann.«
So schildert Martin Mittelmeier bildhaft und mit Humor die Umstände, unter denen der Literaturnobelpreisträger im kalifornischen Exil lebt, zuerst als Hotelgast in einem Bungalow in Beverly Hills, später in Pacific Palisades, anfangs zur Miete, danach in einem eigens errichteten Wohnhaus am San Remo Drive. Anders als andere – man denke nur an seinen Bruder Heinrich – ist Thomas Mann auch in Amerika bekannt, er ist erfolgreich, vermögend, wird hofiert und eingeladen. Von Max Reinhardt, Vicki Baum oder in den Salon der Tschechow-Matriarchin Salka Viertel.
Mittelmeier versammelt sehr lebensnah das Whoʼs who der deutschsprachigen Exilanten in Kalifornien: Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Arnold Schönberg, Franz und Alma Werfel, Lion Feuchtwanger, Bertolt Brecht, Hanns Eisler, Helene Weigel – und in ihrer Mitte Thomas Mann. Sie alle haben im nationalsozialistischen Deutschland keine Heimat mehr und sind an der amerikanischen Westküste gestrandet, im Paradies. Sie sind berührt von den Farben, vom Licht, vom Meer. Doch sie haben Heimweh – Sehnsucht nach einem Land, das der Barbarei verfallen ist, einem Land, in dem sich schreckliche Dinge ereignen.
Heimweh im Paradies hat Martin Mittelmeier sein Buch betitelt, in dessen Zentrum Thomas Mann steht, der König der Emigranten. Er »hasst Hitler, der ihn dazu gebracht hat, das Tisch-Sessel-Bücherregal-Ensemble seiner Münchner Villa zu verlassen«. Doch Mann hat sich einen Vorsatz ins Tagebuch geschrieben, »ein Programm zum Weiterleben und Weiterschreiben. Er muss sich einen Bereich freihalten, in den die Abgründe der Welt draußen nicht hineinreichen. Er braucht Heiterkeit, und ohnmächtiger Hass darf seine Sache nicht sein.«
Dies gelingt ihm. Er schreibt. Er arbeitet am letzten Teil seiner Tetralogie über Joseph und seine Brüder, denkt viel über das Spannungsfeld zwischen Macht und Zugewandtheit nach. Bald kann er es aus nächster Nähe beobachten: Da Mann auch in Amerika als »größter lebender Schriftsteller« gilt, gelingt es ihm, eine Einladung ins Weiße Haus zu erhalten. Wie Mittelmeier schreibt, nutzt er den Besuch bei Präsident Franklin D. Roosevelt auch zur Recherche für seinen abschließenden Band Joseph, der Ernährer.
»Man kann als Schriftsteller so viel lesen, wie man will – aber sich in der Nähe zu seinem Gegenstand zu befinden, ist ungleich wertvoller. In diesem Fall ist der Gegenstand: Größe. Selbstverständliches Charisma einer Führerpersönlichkeit. Das braucht er aktuell für die Ausgestaltung der Figur des Joseph«, schreibt Mittelmeier und lässt anklingen, wie der große Schriftsteller die Menschen seiner Umgebung, auch seine Familie, für seine Werke benutzt. »Er nimmt das Material für seine Bücher, wo immer er es finden kann.«
Nachdem die Josephs-Tetralogie erschienen ist, will Thomas Mann in seinem Doktor Faustus die deutschen Wurzeln des Nationalsozialismus ans Licht bringen. Währenddessen wird der weltscheue Dichter immer mehr zu einer Persönlichkeit, die öffentlich gegen den Faschismus das Wort ergreift, sei es in seinen 55 Radioansprachen an das deutsche Volk (1940–1945) oder in Vorträgen und Zeitungsartikeln.
Mittelmeier arbeitet eindrücklich heraus, wie man Thomas Mann die Rolle einer Galionsfigur des guten Deutschlands zuweist und wie er sich in diese Rolle fügt. Was ist es, deutsch zu sein? Anschaulich erzählt Mittelmeier, wie Thomas Mann während seines Exils mit dieser Frage ringt – und nach Kriegsende 1949 von einer Reise in die Schweiz nicht mehr nach Amerika zurückkehrt. Doch: »Nach Deutschland zu gehen, war keine Option«, bringt es der Autor am Ende seines Buches auf den Punkt: »Deutschland hat er ja in sich, das äußere erträgt er nicht.«
Martin Mittelmeier: »Heimweh im Paradies. Thomas Mann in Kalifornien«, Dumont, Köln 2025, 192 S., 22 €