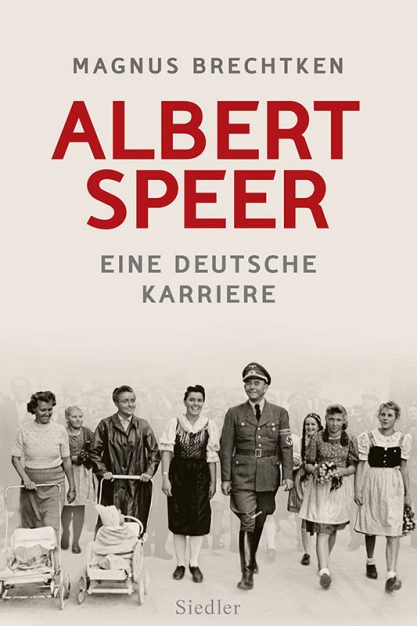Er war Hitlers Lieblingsarchitekt und trug als Rüstungsminister die Verantwortung für das Leid von Millionen Zwangsarbeitern. Und hätte er weniger zur Verlängerung des Krieges beigetragen, hätte für Hunderttausende das Schlimmste in der Tat verhindert werden können. Den Richtern im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher präsentierte er sich als reuiger »guter Nazi«, dem von den Verbrechen des Regimes nichts bekannt gewesen sei, und schwindelte ihnen vor, selbst noch kurz vor dem Kriegsende einen Plan zur Tötung Hitlers ausgearbeitet zu haben. Die Richter glaubten ihm und beließen es bei einer Strafe von 20 Jahren Haft. So blieb er vom Strang verschont.
Auch viele seiner Landsleute glaubten Albert Speer seine Storys. Sie erkannten sich in seiner Darstellung vom verführten Bürger gerne wieder, der nichts vom Judenmord und dem barbarischen Krieg im Osten gewusst haben wollte. So konstruierte sich Speer nach dem Ende seiner Haftzeit in Spandau mit Memoiren, Tagebuch und zahlreichen Medienauftritten eine zweite Karriere, basierend auf einer Vielzahl von Legenden und Lügen.
Mythen Jetzt hat der stellvertretende Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, Magnus Brechtken, eine überaus kritische Speer-Biografie vorgelegt, die den Nimbus und die sich um Hitlers »einzigen Freund« (Speer) rankenden Mythen zur Gänze ins Reich der Erfindung und Manipulation verweist. Eine Art nachgeholte Hinrichtung. Speer sah sich gerne als unpolitischer Fachmann, dem es nur darum gegangen sei, große Teile der Industrie für die Nachkriegszeit zu retten. Aber eine aktive Beendigung des Krieges hat er keineswegs forciert. Im Gegenteil, so der Historiker Brechtken, habe er vorgeschlagen, alle Wehrmachtsverbände sowie den Volkssturm im Westen und Osten zu konzentrieren, um den Feind aufzuhalten. Von Konzentrationslagern und Holocaust, von den Deportationen und dem Vernichtungsprozess wollte er auch erst nach dem Krieg gehört haben; eine »Vernichtung durch Arbeit« als Prinzip sei in einem deutschen Betrieb ausgeschlossen gewesen. Als im Winter 1940/41 die ersten Transporte der Juden aus Berlin nach Lodz, Riga und Minsk abgingen, war Speer zwar nicht unmittelbar für die »Umsiedlung« zuständig, aber an seiner Kenntnis dieser brutalen »Entmietungsmaßnahmen« besteht kein Zweifel, wie aus einer drängenden Aktennotiz vom November 1940 hervorgeht: »Was macht die Aktion der Räumung der tausend Judenwohnungen?«
Zentralfigur Später in Spandau bekannte Speer: »Aber ich war den Prinzipien des Regimes in einem Maße verhaftet, das mir heute nur noch schwer verständlich ist.« Aus dem von Brechtken minutiös untersuchten Aktenmaterial geht auch hervor, wie eng Speer mit der SS zusammengearbeitet hat, als 1942 das Projekt »Vergrößerung Barackenlager Auschwitz infolge Ostwanderung« in Angriff genommen wurde. Speer genehmigte hierfür 13,7 Millionen Reichsmark. Brechtken: »Nicht was Speer nach 1945 über sich erzählt hat, bringt uns dem Verständnis näher, sondern die Analyse seines Tuns, wie es aus den Quellen zu erschließen ist.« Aus der Sicht des Historikers war Speer eine »Zentralfigur des Eroberungs- und Vernichtungskrieges« – ein »Kriegsverlängerer«. Sein Handeln zeige einen Menschen, der den Krieg gegen alle Widerstände und Rückschläge für die Schimäre eines Endsiegs weiter betrieb.
Das deckt sich weitgehend auch mit der Einschätzung des britischen Historikers und Hitler-Biografen Ian Kershaw, der Albert Speer als die »rätselhafteste Persönlichkeit« unter Hitlers Paladinen bezeichnet hat. Er habe keinerlei Skrupel gehabt bei der »zutiefst unmenschlichen Behandlung Hunderttausender ausländischer Arbeiter, die das Regime zur Sklavenarbeit zwang, um dem Reich die Fortsetzung des Kampfes zu ermöglichen, als vernünftige Überlegungen schon längst ein Ende gefordert hätten«.
Brechtkens Speer-Biografie liest sich flüssig, auch spannend. Dass er dabei auch einen Kleinkrieg gegen andere Speer-Biografen wie Joachim Fest und Gitta Sereny oder auch den Verleger Wolf Jobst Siedler führt, denen er vorwirft, die Archive nicht konsultiert und sich von Speer getäuscht haben zu lassen, wirkt mitunter etwas kleinkariert. Unterm Strich schmälert dies aber nicht die Bedeutung seiner Untersuchung.
Magnus Brechtken: »Albert Speer. Eine deutsche Karriere«. Siedler, München 2017, 912 S., 40 €