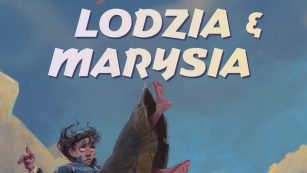Das Kafka-Jahr geht zu Ende, das Jüdische Museum Berlin hat Mitte Dezember die letzte große Kafka-Ausstellung von 2024 eröffnet. »Kafka hätte gesagt: die allerletzte«, erläutert Museumsdirektorin Hetty Berg und verweist auf die Zeilen des jüdischen Schriftstellers: »Der Messias wird erst kommen, wenn er nicht mehr nötig sein wird, er wird erst nach seiner Ankunft kommen, er wird nicht am letzten Tag kommen, sondern am allerletzten.«
Die Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin ist jetzt schon nötig – nicht nur, weil die Auseinandersetzung mit einem der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts keine Frage ist, die sich nur in dessen 100. Todesjahr stellt.
Sie setzt – nach den Kafka-Ausstellungen im Deutschen Literaturarchiv Marbach, in der Bodleian Library Oxford und in der israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem – einen eigenen Akzent und präsentiert Kafka als Künstler, dessen Werk, so heißt es im Katalog, ebenso wenig unmittelbar zu begreifen sei wie die Werke moderner bildender Künstler.
Sie ist wichtig, weil sie den Horizont erweitert. Und nicht zuletzt deswegen ist sie vonnöten, weil unter den in Berlin gezeigten Werken viele von israelischen Künstlern stammen – in einer Zeit, in der viele Kreative aus dem jüdischen Staat sich in der weltweiten Kunstszene mit Boykottaufrufen konfrontiert sehen. Dass zahlreiche Israelis vertreten sind, erklärt Kuratorin Shelley Harten unter anderem damit, dass sie sich selbst in der israelischen Kunstszene gut auskennt.
Im Treppenhaus zum ersten Stock hängen Plakate mit der Inschrift: »Wer Künstler werden will, melde sich!«
Access Kafka heißt die Ausstellung. Im Treppenhaus zum ersten Stock hängen Plakate mit der Inschrift: »Wer Künstler werden will, melde sich!« Der Aufruf ist ein Zitat aus Franz Kafkas unvollendetem Roman Der Verschollene beziehungsweise Amerika. Die Figur Karl Roßmann, in die USA ausgewandert, wird in dem Buch mit einem gleichlautenden Aufruf des »Naturtheaters von Oklahoma« konfrontiert. Weiter heißt es in dem Appell: »Jeder ist willkommen!«
Gezeigt werden Handschriften und Zeichnungen aus dem Nachlass
Dasselbe gilt auch für Access Kafka. Die Schau gibt in sechs Räumen einen Einblick, der niedrigschwellig funktioniert – auch für Besucher, die mit Kafkas Werk nicht oder kaum vertraut sind. Gezeigt werden Handschriften und Zeichnungen aus dem Nachlass, zum Teil als Leihgaben aus Jerusalem, Oxford und Marbach. In jedem Raum liegt ein Blatt zum Mitnehmen mit einem Kafka-Text wie Ein Hungerkünstler (1922) oder Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse (1924).
Doch diese Ausstellung ist auch etwas für Leserinnen und Leser, die Kafkas Werk gut kennen – und für diejenigen, die es gerne besser verstehen wollen, aber immer noch im Schloss feststecken. Es gebe einen Weg, so Kuratorin Shelley Harten im Ausstellungskatalog, »das Bedrückende, die Spannungen in Kafkas Werk und die Widersprüche seiner Person auszuhalten«. Der Schlüssel liege »in dem Versuch, Kafka als bildendem Künstler und seinen Texten als Skulpturen oder Gemälden zu begegnen, die in einer Ausstellung neben anderen Kunstwerken räumlichen Bestand haben«.
Was Franz Kafka wohl dazu gesagt hätte? Selbst lehnte er Illustrationen seiner Werke ab. Seinen Verleger Kurt Wolff wies er an, dass Gregor Samsa keinesfalls als Käfer auf dem Einband von Die Verwandlung erscheinen dürfe: »Das Insekt darf nicht gezeichnet werden. Man darf es nicht einmal aus der Ferne sehen.«
Ein Chor singt das jiddische Partisanenlied »Mir Zaynen Do!«
Vor dem Raum »Access Judentum« hängen zwei schwarze Vorhänge. Wer sie zur Seite schiebt und den Raum betritt, steht direkt vor einer Videoinstallation von Yael Bartana aus dem Jahr 2024. Ein Chor aus weißen Sängerinnen und Sängern singt das jiddische Partisanenlied »Mir Zaynen Do!«.
Dazwischen treten schwarze Sängerinnen in prächtigen Kostümen auf. Der Saal ist fast leer, zum Schluss bleibt die Chorleiterin, eine ältere, sehr korrekt gekleidete weiße Frau mit Perlenkette, als Einzige zurück. Die rostigen Stühle lassen alle Assoziationen zu, von Vergänglichkeit im Allgemeinen bis hin zu den gestapelten Autowracks der Opfer des Massakers vom 7. Oktober 2023 beim Nova-Festival im Süden Israels.
Wer sind Yael Bartanas Sänger, warum haben sie ein Lied gewählt, das – so der jiddische Text – »ein Volk zwischen fallenden Wänden mit Gewehren in den Händen« gesungen hat? Der Katalog gibt Auskunft: »In den Ruinen des Teatro de Arte Israelita Brasileiro« (TAIB), im Keller der Casa do Povo in São Paolo treffen zwei Gruppen wie im Traum aufeinander: Ilú Obá De Min, ein afro-brasilianisches Straßenmusikensemble, (…) und der Coral Tradição, ein jüdisch-brasilianischer Chor, der jiddische Lieder singt. (…) Beide Gruppen treten auf, performen ihren Zusammenhalt und fragen, wem die Bühne künftig gehören wird.«
Viele israelische Künstler sind vertreten – wie Yuval Barel, Yael Bartana, Guy Ben-Ner, Uri Katzenstein, Alona Rodeh und Roee Rosen.
Erschütternd ist im selben Raum das Kunstwerk Luftmensch Antiexodus (2020) des israelischen Malers Yuval Barel, ein Schwarz-Weiß-Acrylbild eines Menschen, der mit einem Vogel auf dem Boden sitzt, im Hintergrund ein Gebäude mit einem Schornstein, aus dem Rauch aufsteigt.
Im Katalog untersucht Literaturwissenschaftlerin Vivian Liska die Beziehung Kafkas zum Judentum: »Die Verfehlung eines Ziels (…) entspricht jener grundlegenden Auffassung der jüdischen Texttradition, dass die Bibel sich ›nicht im Himmel befindet‹, sondern auf Erden. Sie zeigt eine Richtung an, kein Resultat. Sie lädt nicht zum Eintritt ein, sondern, wie Kafka den Mann vom Lande vor dem Gesetz, zu einer lebenslangen Auseinandersetzung mit ihm und allem, wofür es steht.«
Im Raum »Access Gesetz« liegt die Türhüterparabel aus
Im Raum »«Access Gesetz«, wo Kafkas Türhüterparabel ausliegt, ist ein 56 Minuten langes Video des israelischen Künstlers Roee Rosen zu sehen. Der lässt seine Lebensbeichte von Migrantinnen auf Hebräisch nachsprechen, die illegal in Israel leben und die Sprache des Landes nicht verstehen. The Confessions of Roee Rosen (2007/2008) ist (als Auseinandersetzung mit einem Schoa-Überlebenden als Vater und fiktiven Einblicken in die Kanalisation von Gush Dan) eines der schockierendsten Werke in der Schau. Daneben läuft der kurze Animationsfilm Altars Made of Sand (2023) von Alona Rodeh.
Im Eingangsbereich wird ein kurzes Video, Strike (2010), der deutschen Filmemacherin Hito Steyerl präsentiert, in dem jemand einen Flachbildschirm mit Hammer und Meißel aktiviert. Im mittleren Raum steht ein Karussell von Martin Kippenberger, das der Künstler 1991 vollendet hat. Ein Schleudersitz auf bunten Schienen wird für eine wilde Fahrt aktiviert – Sinnbild für einen künstlerischen Teufelskreis, der nur von demjenigen unterbrochen werden kann, der an der Kurbel steht.
Und es gibt Werke von Marcel Duchamp, Maria Lassnig, Maria Eichhorn, Trevor Paglen, Guy Ben-Ner, Mary Flanagan, Cory Arcangel, Uri Katzenstein und anderen, die man in Ruhe auf sich wirken lassen muss. Planen Sie nicht weniger als drei Stunden für Access Kafka ein, verzichten Sie nicht auf den Katalog – aber schauen Sie zuerst die Kunst an. Ihr Kopf wird sich öffnen. Vielleicht erschrecken Sie über Ihre Gedanken, aber danach werden Sie sich besser fühlen.
Der Messias wird erst kommen, wenn es nicht mehr nötig ist, schreibt Franz Kafka. Bis es so weit ist, trösten wir uns mit Access Kafka im Jüdischen Museum Berlin.
Die Ausstellung ist bis zum 4. Mai 2025 im Jüdischen Museum Berlin zu sehen.