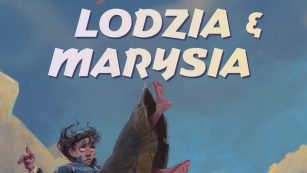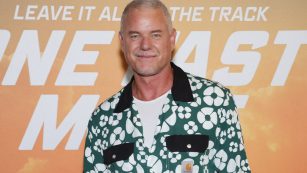»Schlamassel«, »Dufte« oder »Hals- und Beinbruch« - dutzende Wörter und Begriffe haben ihren Weg vom Jiddischen ins Deutsche gefunden. Und auch umgekehrt - denn Jiddisch ist ebenfalls eng mit dem Deutschen verflochten. Mit dem Holocaust wurde die Sprache in Europa weitgehend ausgerottet - in der Netflix-Serie »Unorthodox« wird sie in diesen Wochen wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt.
Trotz Verfolgung und Exil - Jiddisch hat sich bis heute erhalten. Die Welt des chassidischen Judentums, aus der Esty Shapiro (Shira Haas) in »Unorthodox« flüchtet, ist die Welt des Jiddischen. »Die meisten Jiddisch sprechenden Menschen heute sind religiöse Juden in Israel und den USA«, sagt Leonid Roitman vom Zentrum Beit Schalom Aleichem in Tel Aviv. Die mehr als tausend Jahre alte Sprache wird unter anderem in Brooklyn, Buenos Aires, London, Antwerpen oder Jerusalem noch häufig gesprochen.
Wie lebendig die Sprache ist, beweist auch die Veröffentlichung eines speziellen Jiddisch-Wörterbuchs für die Corona-Krise. Dort erscheinen Ausdrücke wie »Die Farschparung« (Die Ausgangssperre), »opgesundert« (isoliert) und »Oisplatschikn die Krume« (Die Kurve abflachen). Auch ein jiddischer Corona-Song mit dem Titel »Lomir Zayn Gezint!« (Lass uns gesund bleiben) kursiert in sozialen Medien.
Die Mischung aus Hebräisch, Mittelhochdeutsch und slawischen Einflüssen ist aber viel mehr als das Klischee von Pejes und Klezmer. Und immer mehr junge Menschen, auch Nicht-Juden, lernen weltweit Jiddisch.
Bis zum millionenfachen Mord an den Juden wurde Jiddisch nicht nur von den Religiösen gesprochen. Mehr als zehn Millionen Menschen zwischen Kiew und Berlin sprachen Jiddisch, es gab Verlage für jiddische Literatur und Zeitungen mit Nachrichten auf Jiddisch. Hebräisch war die Sprache der Religion, Jiddisch für den Alltag.
Im 19. Jahrhundert, als Europas Völker nach eigenen Nationalstaaten strebten, wurde Jiddisch für die viele Juden ebenfalls Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins, wie Elke-Vera Kotowski, Kulturissenschaftlerin am Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam, sagt. Sie bereitet gerade eine Ausstellung über jiddische Literatur vor.
Autoren wie Scholem Aleichem, auf dessen Buch »Tewje, der Milchmann« der Broadway-Hit »Fiedler on the Roof« zurückgeht, gaben dem Jiddisch eine Bedeutung über die Alltagssprache hinaus, wie die Literaturwissenschaftlerin sagt.
Und Jiddisch erhielt die höchsten Weihen der Literaturwelt: Der polnisch-amerikanische Autor Isaac Bashevis Singer, der seine Erzählungen auf Jiddisch schrieb, wurde 1978 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Seine Dankesrede hielt Singer selbstverständlich auf Jiddisch.
Doch im Jiddischen hatten auch deutsche Klassiker und die Weltliteratur großen Erfolg. Kotowksi hat bei ihren Nachforschungen mehr als 200 Titel von Übersetzungen vom Deutschen ins Jiddische gefunden - unter anderem Thomas Manns »Zauberberg«, übersetzt vom späteren Nobelpreisträger Singer. Es gab auch Kinder- und Jugendliteratur, die Märchen der Brüder Grimm etwa, »Max und Moritz« wurden zu »Notl un Motl«. In deutschen Bibliotheken finden sich heute so gut wie keine jiddischen Übersetzungen. Die Nazis vernichteten weitgehend diesen Kulturschatz, sagt Kotowski.
Roitman ist beim Zentrum Beit Schalom Aleichem für die Jiddisch-Kurse zuständig. Dort lernen 400 Schüler in verschiedenen Stufen Jiddisch. »Wir haben jedes Jahr etwa 100 Anfänger, darunter auch junge Menschen«, sagt er.
Die Beweggründe, Jiddisch zu lernen, seien unterschiedlich. »Es gibt viele, die eine emotionale Bindung an die Sprache haben, zum Beispiel die Erinnerung an eine Großmutter oder eine familiäre Tradition.« Andere seien einfach neugierig. »Es gibt auch viele Forscher, die Jiddisch für ihre Arbeit brauchen. Man kann die moderne hebräische Literatur und die Geschichte des jüdischen Volkes ohne Jiddisch nicht verstehen.«
Yael Goldmann hat mehrere Jiddisch-Kurse belegt. Sie ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, lebt aber schon seit Jahrzehnten in Israel. Jiddisch kannte sie vor allem aus dem Haus ihrer Großeltern. »In dem Moment, in dem die Generation, die Jiddisch sprach, nicht mehr da war, hat es mir gefehlt«, erklärt sie ihre Motivation zur Vertiefung der Sprachkenntnisse. »Es geht mir wie den meisten in diesen Kursen, wir wollen an die Vergangenheit anknüpfen und sie lebendig halten.«
Das Jiddisch in der Serie »Unorthodox« sei indes sehr anders als im Hause ihrer Großeltern. »In der Serie ist es eher Jinglisch, mit vielen englischen Wörtern vermischt.«
Tatsächlich hat Jiddisch immer wieder auch die Einflüsse der Sprachen in der jüdischen Diaspora aufgenommen. »S’iz geven der greste mistake in mayn leybn«, heißt es in »Unorthodox« etwa.
Goldmann nimmt bis heute an vielen Jiddisch-Konzerten und Literaturabenden teil. Ob »Der kleine Prinz«, »Harry Potter« oder »Struwwelpeter«: »Das ist dann natürlich köstlich, es auf Jiddisch zu lesen.« Das Yiddishpiel in Tel Aviv führt Theaterstücke in jiddischer Sprache auf - mit hebräischen Untertiteln.
Jehuda Brayer spricht Jiddisch schon von Kindesbeinen an. Der 24-Jährige lebt in einem charedischen Viertel in Jerusalem. Seine Großeltern stammen aus Wien. »Jiddisch ist meine Muttersprache«, sagt Brayer. Er spricht sie im Alltag mit seinen Eltern, seiner Frau und seinen Kindern im Alter von knapp drei und eineinhalb Jahren.
Hebräisch verwendet Brayer vor allem im Kontakt mit der Außenwelt, »in der Bank, in meinem Geschäft«. Die Kinder lernen Hebräisch erst in der Religionsschule. Es ist auch die Sprache, in der sie lesen. Brayer sieht die Zweisprachigkeit als großen Vorteil.
»Jiddisch ist für mich die Sprache von uns Juden«, erklärt er. »Etwas, das fast ausgerottet und dann wieder zum Leben erweckt wurde. Sprache ist auch Identität: Jiddisch diente als Verbindungsglied zwischen allen Juden in Europa.«