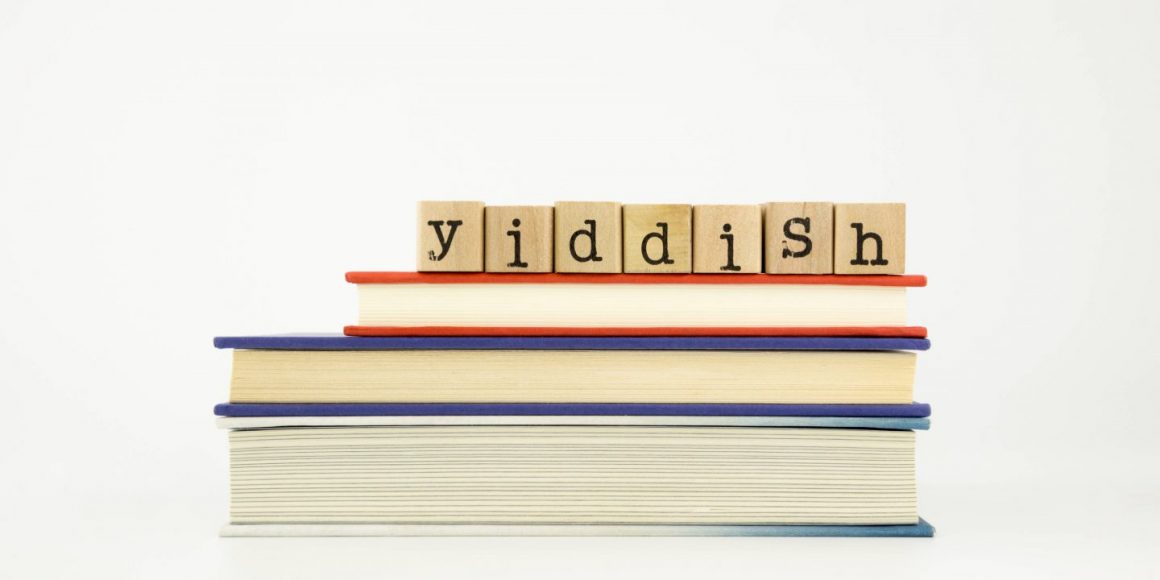Zwischen Köln, Regensburg und Metz lag einst die Wiege des aschkenasischen Judentums. Aschkenas steht in der talmudischen Tradition für die Gegend des späteren Deutschlands nördlich der Alpen. In diesem Jahr feiern wir über 1700 jüdisches Leben in Deutschland - oder richtiger formuliert, am Rhein und in deutschen Landen.
Denn Deutschland existierte im Jahr 321 noch nicht. Die wechselhafte Geschichte beinhaltet Blüte, Selbstbehauptung, Austausch, aber auch Pogrome, Flucht, Vertreibung und Wanderung wie Rückwanderung und das Menschheitsverbrechen der Schoa.
BEGRIFFE Bundespräsident Steinmeier wünschte sich für das Festjahr »ein klares Bekenntnis, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland ein Teil von uns sind, ein Teil unseres gemeinsamen Wir, sondern dass wir denen entschieden entgegentreten, die das noch oder wieder infrage stellen.« Wenn diese Forderung nicht einfach so dahin gesagt sein soll, muss sie auch für den Rückblick und die Deutung unserer Geschichte gelten: Spuren nationalistischer und völkischer Geschichtsschreibung sollten Anlass für Neubewertungen sein. Wo sie für Begriffe und Zugehörigkeiten prägend waren, sind sie in Frage zu stellen und zu dekonstruieren.
Zur 1700-jährigen Geschichte gehört auch »Teitsch«, oder »Loschen Aschkenas« (die Sprache Deutschlands), das »Mameloschen«, die Jahrtausende alte Muttersprache des aschkenasischen Judentums. Erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts setzte sich dafür, zunächst in den USA, der Neologismus »Jiddisch« durch. Kommende Woche, am 24. und 25. Oktober, thematisiert eine Tagung des Tikvah-Instituts und der Konrad-Adenauer-Stiftung diese besondere Sprache, ihre Geschichte und ihren Beitrag zur europäischen Kultur.
Der älteste überlieferte jiddische Satz, wohlgemerkt nicht das erste Sprachdenkmal, stammt von 1272. Er findet sich in einem Feiertagsgebetsbuch, dem Wormser Machsor (מחזור). Das sind immerhin schon 950 Jahre nach dem Edikt des Kaisers Konstantin und dem somit ersten Zeugnis jüdischen Lebens am Rhein. Dieses kaiserliche Zeugnis ist der Anlass des Festjahres, zeigt es doch, dass in der »Claudischen Kolonie und Opferstätte der Agrippinenser«, heute als die Stadt Köln bekannt, wahrscheinlich eine prosperierende jüdische Gemeinde lebte.
VERTREIBUNG Sprachen sind lebende Dokumente der Geschichte einer Gemeinschaft. Im Wortschatz und in grammatikalischen Konstruktionen sind oft nach langer Zeit noch Spuren vergangener Ereignisse und vielfältiger Austauschbeziehungen zu finden, seien es Wanderungen, Kulturkontakte oder auch Machtverhältnisse.
Aufgrund und nach den Pogromen während der Kreuzzüge und der Großen Pest wurde das Zentrum des aschkenasischen Judentums im 15. und 16. Jahrhundert gewaltsam durch Vertreibung und der Emigration nach Osteuropa, genauer nach Polen und Litauen, verschoben. Vor dieser Zeitenwende sprachen jüdische und christliche Nachbarn laut dem Pariser Jiddisten Beider noch überwiegend die gleichen lokalen deutschsprachigen Dialekte.
Die Weiterentwicklung als Minderheitensprache in einer fremdsprachigen Umgebung, so wie es zumindest beim Ostjiddischen der Fall war, begann erst danach. Wie sich Minderheiten- und Mehrheitssprachen im Kontakt miteinander verhalten, werden Sprachwissenschaftler, Germanisten und Jiddisten bei der Tagung besprechen, um neue Perspektiven auf die jiddische Sprache einem breiten Publikum vorzustellen.
Die Zuschreibung von Hochsprache und Dialekt, die Betrachtung von Gemeinsamen und Trennendem und das Bewusstsein einer Sprachgemeinschaft sind Ausdruck wie Gegenstand auch politischer Machtverhältnisse. Die jiddische Sprache und Kultur waren in den letzten Jahrhunderten vielfach Spielball der Politik.
VERBINDUNGEN Während des Ersten Weltkrieges gab es in Deutschland eine Diskussion, ob man die Jiddisch sprechenden Jüdinnen und Juden als »kulturellen Vorposten des Deutschtums im Osten« betrachten könne. Die UdSSR erkannte das Jiddische als Nationalsprache der sowjetischen Juden an, unterdrückte aber das Hebräische. Die zionistische Bewegung und Israel machten wiederum Ivrit, das moderne Hebräisch, zur Sprache des jungen Staates.
Die kulturellen Verbindungen der jiddischsprachigen und der deutschen Kultur sind vielfältig: So hat der Leiter des Yiddish Summer Weimar, Andreas Schmittges, zahlreiche Parallelen und Gemeinsamkeiten zwischen deutschem und ostjiddischen Liedgut herausgearbeitet.
Noch 1932 schrieb der Redakteur des Berliner Tageblatts, Rudolf Olden: »Die Ostjuden kommen aus Rußland, wo sie keine gute Zeit gehabt haben. Wenn dort einer bildungsbeflissen war und das warn nicht wenige von ihren, und das waren nicht wenige von ihnen, und er streckte den Kopf über den Talmud heraus, so las er Goethe. Er las Schiller. Er las Kant und Schopenhauer. Sie sprachen ohnehin jiddisch, von da ist es nicht weit bis zu deutsch.« Die Intensität dieser Verbindungen unterstreicht auch ein gerade von Elke-Vera Kotowski vorgelegtes exzellent recherchiertes Buch über jiddische Übersetzungen deutschsprachiger Literatur in der Zwischenkriegszeit.
NATIONALSTAATEN In der Sprachwissenschaft wurde um den Rang des Jiddischen lange gestritten. Gegen Abwertungen als »Sondersprache« oder Dialekt wurde erbittert gekämpft. Der renommierte Sprachwissenschaftler Max Weinreich brachte es pointiert auf den Punkt: »Eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und einer Marine.«
Wer die Willkür von dergleichen normativen Setzungen nachvollziehen will, werfe nur einen Blick in eine x-beliebige Kommentierung des § 23 Verfahrensgesetz: »Die Qualifizierung einer Sprache als Regional- oder Minderheitensprache, schließt nicht aus, dass diese zugleich als Mundart (Dialekt) einer anderen Amtssprache zu werten ist.« Und nicht nur das: So ist das Lëtzebuergesch Amtssprache in Luxemburg und zugleich lediglich eine moselfränkische Sprachvarietät des Westmitteldeutschen. Soviel Ambiguität ist sprachwissenschaftlich wie rechtlich möglich.
Der Zusammenhang von Sprachen, Ethnien, Nationen und Staaten sind Identitätsfragen, die bei der Herausbildung der Nationalstaaten heftig umstritten waren. Stellt man das volontaristische oder republikanische Konzept der französischen Republik (»L’existence d’une nation est un plébiscite de tous les jours«) des Philologen Ernest Renan oder Jacob Grimms Satz »Ein Volk ist der Inbegriff von Menschen, welche dieselbe Sprache reden« einander gegenüber, wird dieses nur allzu deutlich.
GERICHTSURTEILE Dabei sind diese Diskussionen nicht nur Themen für das Feuilleton. Sie haben auch ganz praktische Auswirkungen im Hier und Jetzt: Heute werden aus der Sowjetunion stammende Jüdinnen und Juden, von denen seit 1990 etwa 200.000 nach Deutschland eingewandert sind, bei der Rente gegenüber den seitdem eingewanderten 2,2 Millionen Spätaussiedlern aus der UdSSR benachteiligt. Die Begründung dafür gehört auf den Prüfstand: Deutsche Verwaltungen und Gerichte haben das aschkenasische Judentum wie dessen historische Muttersprache aus dem »deutschen Sprach- und Kulturkreis« einfach hinausdefiniert.
Ob die Begründungen dieser Verwaltungspraxis sprachwissenschaftlich und historisch so zu halten sind, muss dringend hinterfragt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) argumentierte 1973: »Jiddisch ist nicht Deutsch. Jiddisch ist die Sprache der Ostjuden; es vermittelt den Zugang zur jüdischen Kultur, nicht zur deutschen.« Sozialgerichte wie der BGH selbst bestätigten und variierten seitdem diese Rechtsprechung.
Richtig ist die Aussage und Argumentation des BGH nicht: Jiddisch vermittelt allein den Zugang zur aschkenasischen jüdischen Kultur, aber eben nicht zur sephardischen Kultur (auf der iberischen Halbinsel) und ihrer Sprache, das Ladino. Es gibt zahlreiche jüdische Sprachen, nicht nur das Jiddische. Dieser Umstand scheint den deutschen Obergerichten völlig entgangen zu sein. Zumindest haben sie ihn nicht verstanden. Völkische Identitätsdefinitionen – eine Ethnie hat nur eine Sprache – und ein nationalistischer, anachronistischer Blick in die Geschichte scheinen hier durch.
Es wurde dabei ein apodiktischer Gegensatz von jüdischer und deutscher Kultur aufgebaut. In Sonntagsreden – wenn es mal nicht ums Geld geht – wird hingegen ein ganz anderes Verhältnis beschworen.
BUNDESTAG Die Rechtsprechung liegt allerdings auf der Linie des Gesetzgebers. Der Bundestag sagte noch 1989 einhellig: »Die Zugehörigkeit zum deutschen Sprach- und Kulturkreis bedeute, dass Deutsch wie eine Muttersprache im persönlichen Bereich überwiegend benutzt worden sein müsse und dadurch ein Zugang zur deutschen Kultur möglich gewesen sei.« Von Mehrsprachigkeit, von einer kritischen Reflexion der deutschen Geschichte keine Spur nirgends.
Ebenso wenig zeugt diese Stellungnahme zum Fremdrentengesetz von einer historisch-kritischen Verwendung des Begriffes der »deutschen Kultur«. Es ist der gleiche Bundestag, es sind die gleichen Fraktionen, die nur ein Jahr später angesichts der Chance auf jüdische Zuwanderung aus der Sowjetunion von der »Revitalisierung des jüdischen Elements im deutschen Kultur- und Geistesleben« träumen, die glauben, dass die sowjetischen Juden »unsere Mitbürger werden können«, die sich beim Jiddischen an den »wundersame[n] Klang mittelalterlichen deutschen Sprechens« erinnert fühlen. Letzteres leider ohne politische Konsequenz.
Der Jiddist Simon Neuberg erinnert daran, dass »das Jiddische mit dem Deutschen kulturell durch seine ganze Geschichte verbunden ist, - und was das Westjiddische angeht, bis ins 18. Jh. zur Kulturgeschichte in Deutschland gehört.« Germanisten und Jiddisten können den vielfältigen kulturellen Austausch zwischen der Jiddischen und Deutschen Kultur vielfach belegen.
Die Übernahme der Rechtsfigur des »deutschen Sprach- und Kulturkreis« in die deutsche Gesetzgebung verdanken wir einer Rechtstradition und ‑entwicklung, die Grund genug sein sollte, bisherige Begriffsprägungen in Frage zu stellen. Mit dem Staatsbürgerschaftsgesetz von 1913 wurde das ius sanguinis zum Kern deutschen Staatsvolksverständnis.
Man reagierte damit auf eine Notwendigkeit der Kolonialgeschichte: Die Staatsbürgerschaft sollte durch Abwesenheit vom Mutterland nicht verloren, sondern auch auf Nachkommen in der kolonialisierten Fremde übertragen werden können - aber ohne, dass die Kolonisierten ebenfalls diesen Status und die damit verbundenen Privilegien bekamen.
VÖLKISCHES VERSTÄNDNIS Das hatte Weiterungen: 1939 formulierte ein Runderlass des Reichsinnenministerium »Deutscher Volkszugehöriger ist, wer sich als Angehöriger des deutschen Volkers bekennt, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte Tatsachen, wie Sprache, Erziehung, Kultur usw. bestätigt wird.« Fast wortgleich ging die Definition dieses Erlasses in das Bundesvertriebenengesetz ein. An Globkes damaliger Interpretation, dass »Personen artfremden Blutes [sic!], insbesondere Juden und Zigeuner, … jedoch niemals deutsche Volkszugehörige [sind], auch wenn sie sich etwa bisher in der Tschecho-Slowakei zur deutschen Nationalität gerechnet haben sollten,« hielt man freilich nicht fest.
Im Bundesentschädigungs- und Fremdrentengesetz verzichtet man zudem auf das Bekenntnis zum »deutschen Volkstum«; das wollte man von Juden angesichts der Shoah dann doch nicht verlangen, substituierte es aber durch die Zugehörigkeit zum »deutschen Sprach- und Kulturkreis«. Das damit zugrunde gelegte Verständnis, dass man nicht gleichzeitig jüdische und deutsche Wertvorstellungen hegen oder Traditionen pflegen konnte, wie die juristische Kommentarliteratur es sagt, lässt sich nicht ernsthaft aufrecht erhalten.
Hier hat sich durch die Hintertür doch ein völkisch-nationalistisches Geschichts- und Kulturverständnis eingeschlichen. Nehmen wir die politischen Mahnungen ernst und bewerten wir das Sprachverhältnis neu!
Am 24. und 25. Oktober 2021 findet in der Konrad-Adenauer-Stiftung Berlin eine Tagung des Tikvah Instituts zum Thema »Wie deutsch ist Jiddisch?« statt. Weitere Informationen dazu gibt es hier.
Volker Beck war von 1994 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestag. Seither ist er Lehrbeauftragter für Religionspolitik am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien (CERES) der Ruhr-Universität Bochum und seit Kurzem auch Geschäftsführer des Tikvah Institut.