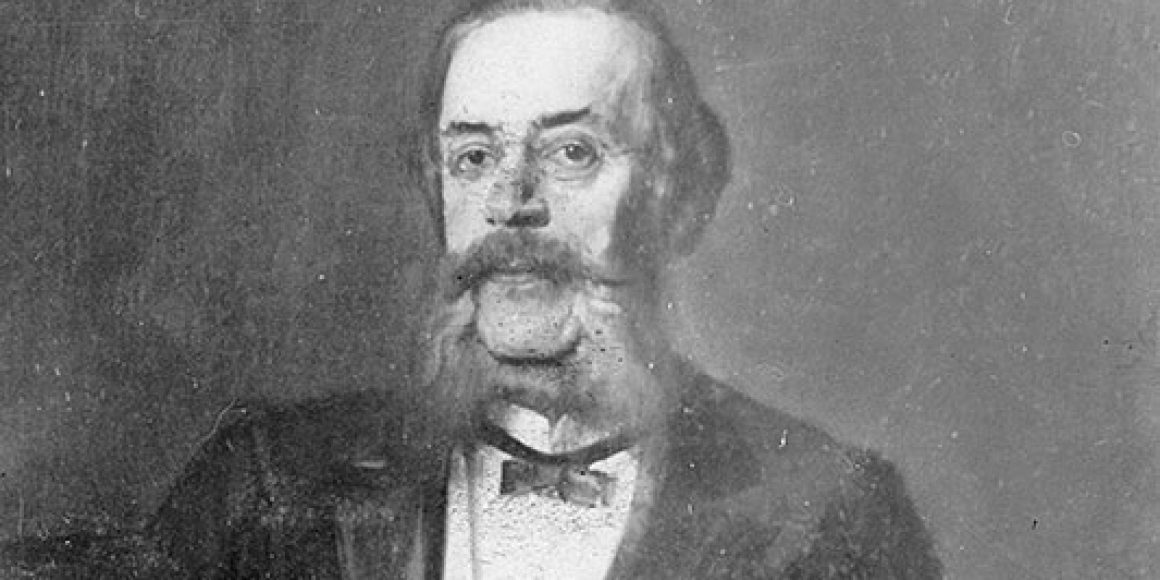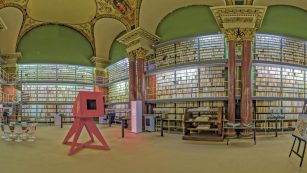Wäre es nach Theodor Herzl gegangen, hätte der von ihm geplante Judenstaat die Verfassung einer aristokratischen Republik bekommen. 1895 bekannte er: »Übrigens, wenn ich etwas sein möchte, wär’s nur ein preußischer Altadliger.« Für Herzl blieb der deutsche Adel immer Ideal und Vorbild, selbst nach seiner Bekehrung zum Zionismus. Und damit stand Herzl ganz offensichtlich nicht allein.
Judentum und Adel – geht das zusammen? Auf den ersten Blick liegt nichts ferner, als eine jüdisch-adlige Schnittmenge zu vermuten. Kai Drewes hat sich auf archivalische Spurensuche begeben, um dieses Thema im europäischen Vergleich auszuloten. Als Ergebnis seiner kulturwissenschaftlichen Untersuchung lässt sich festhalten, dass insbesondere deutsche Juden nach »jeder Auszeichnung hungerten«, um damit ihre »komplette Deutschwerdung« zu vollziehen.
Dafür steht exemplarisch Bismarcks Bankier und Berater Gerson (von) Bleichröder, einer der ersten jüdischen Neuadligen. Nirgendwo sonst als in Deutschland waren Juden in ihrer Assimilationswut sogar bereit, sich vom Judentum zu entfremden. Staatlicherseits wurde von den Juden der Übertritt zum Christentum erwartet. Nicht von ungefähr begegnete Drewes in den Akten häufig die so abwertende wie erwartungsvolle Formulierung »noch Jude«.
Taufe In seinem Erfolgsroman Jettchen Gebert (1906 ff.) schildert Georg Hermann den Berliner Großbürger Jason Gebert als immun gegenüber allen Konversionsversuchen, was bedeutete, dass auf ein »von« im Familiennamen verzichtet werden musste. Hermann lässt seinen Protagonisten sagen: »Und dass wir das nicht getan haben und nicht zu Kreuze gekrochen sind und in keiner Weise unsere Gesinnung verkauft haben (…) – das ist unser Stolz.«
Das Entreebillet zum Adelsstand war die Taufe. Der jüdische Wunsch nach Auszeichnung ist umso erstaunlicher, als der angestammte preußische Adel im Kaiserreich kein Hehl aus seiner Abneigung gegen alles Jüdische machte. Auch wenn die Bereitschaft einer längst konvertierten Familie besonders groß war, das Herkunftsmilieu hinter sich zu lassen, so ist bezeichnend, welche Hinderungsgründe dem Adelsdiplom trotzdem im Wege standen: der jüdische »Typus im Äußeren« und der »jüdische Akzent«!
So geschehen bei der Familie Oppenfeld. Hier war es schließlich der Prinzregent Wilhelm (I.) selbst, der sich über die physiognomisch begründeten Bedenken hinwegsetzte. Anders bei Orden, die eine christliche Symbolik aufwiesen: Hier wollten die Könige einem jüdischen Kandidaten kein christlich konnotiertes Ehrenzeichen verleihen und wählten statt der Kreuzesform eine ovale Medaille.
Nachfrage Adelsauszeichnungen erfolgten allein aus Nützlichkeitserwägungen, denn der Geadelte sollte anschließend seine Wohltaten umso großherziger erkennen lassen. Ablehnung und Spott gegen eine jüdische Titel- und Ordensjagd schlugen den Juden in Deutschland allenthalben entgegen. Anders in Großbritannien, wo die Erhebung Nathaniels de Rothschild zum ersten Lord jüdischen Glaubens 1885 von den britischen Juden enthusiastisch begrüßt worden war.
Insgesamt war das Muster für den Adelswunsch von Juden europaweit ähnlich: Die Nachfrage nach Adelstiteln war überall hoch, und die Initiative zur Nobilitierung ging in der Regel von dem zu Adelnden aus – wobei auch gläubige Juden für Titel und Auszeichnungen empfänglich waren, nicht mehr und nicht weniger als Christen.
Großbürger Die in der Literatur vielfach abfällig als »Kaiserjuden« geschmähten Personen, die sogar trotz einer Offerte Wilhelms II. einen Adelstitel stolz abgelehnt haben sollen (wahrscheinlich ist eine solche Offerte nie erfolgt), liest sich eindrucksvoll als Liste namhafter jüdischer Großbürger – unter ihnen kaum Konvertiten: Albert Ballin, Carl Fürstenberg, Rudolf Mosse, Emil und Walter Rathenau, Franz Ullstein, Moritz und Max Warburg, um nur einige zu nennen.
Der in der tonangebenden Historiografie behauptete Eindruck, nicht konvertierte Juden seien besonders unempfindlich gegenüber Adelstiteln gewesen, weist Drewes jedoch als »nicht belegbar« und »nachträgliche Projektion« zurück. So kommt er zu der Feststellung: »Wilhelminische Juden, die eine Nobilitierung ablehnten, wenn sie ihnen sogar angeboten wurde, gab es nicht.«
Der Zusammenhang zwischen Vermögen, Konfession und Adelung war überdeutlich, wenn man die 29 Personen betrachtet, die um 1900 zu den 100 größten Vermögensbesitzern Preußens gehörten und jüdischer Herkunft waren.
Es gab keinen Automatismus, wonach in dieser Spitzenschicht des Bürgertums der Taufe die Adelsverleihung folgte. Doch die Häufung von Auszeichnungen an konvertierte reiche Familien ist evident. Und damit unterschieden diese sich nicht signifikant von jüdischen Bankiers und Industriellen in London, Paris, Wien, Budapest, Rom und anderswo, wo Adelstitel zur gleichen Zeit ebenfalls hoch im Kurs standen.
Kai Drewes: »Jüdischer Adel. Nobilitierungen von Juden im Europa des 19. Jahrhunderts«. Campus, Frankfurt 2013, 467 S., 49 €