Identität und Zugehörigkeit
Wie wäre mein Leben in Israel verlaufen? Und wie hat Deutschland mein Leben und meine persönliche Entwicklung beeinflusst? Solche Fragen stelle ich mir in diesen Tagen, genau 25 Jahre, nachdem ich mit meiner Familie aus Minsk nach Deutschland gekommen bin. Es war die Entscheidung der Eltern, in den 90er-Jahren nicht – was damals naheliegend erschien – nach Israel, sondern in die Bundesrepublik auszuwandern.
Die Tragweite dieser Entscheidung bringt auch Autoren wie Dmitrij Kapitelman zum Nachdenken. In seinem 2016 erschienenen autobiografischen Debüt Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters widmet sich der 1986 in Kiew geborene Schriftsteller und Journalist, der ebenfalls als sogenannter Kontingentflüchtling nach Deutschland kam, vor allem der Klärung seiner Beziehung zum jüdischen Staat.
Kapitelman erinnert sich an die bei Weitem nicht selbstverständliche Auswanderung nach Deutschland: »Beinahe wären wir damals nach Israel ausgewandert. Die Visa waren schon bewilligt, die Koffer gepackt. Doch dann kam Deutschland.« Auch blickt er auf die psychischen Kosten der 1994 vollzogenen Emigration: »Seitdem sind wir hier, dennoch hat Papa Deutschland nie als neue Heimat akzeptiert.«
Eine Reise nach Israel, auf der Kapitelman seinen Vater besser kennenlernen und verstehen möchte, wird für den Autor zu einer inneren Selbstbefragung seiner jüdischen Identität. Am Ende legt er sich fest: »Wenn überhaupt, bin ich ein deutscher Jude. Und nicht kompatibel mit Israels Gesellschaft.«
Das Erstaunlichste an Dmitrij Kapitelmans Debüt ist die Leichtigkeit, mit der er existenzielle Fragen nach Identität und Zugehörigkeit verhandelt. Kapitelman schafft es durch einen schöpferisch-spielerischen Umgang mit der Sprache und fein dosierten Humor, der Thematik jede unnötige Schwere zu nehmen.
Eugen El
Dmitrij Kapitelman: »Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters«. Hanser, Berlin 2016, 288 S., 20 €

Fenster in die Seelen
»Seine Stimme, seine Hände, der schüttere Bart, die mageren Hände, alles war voller Leben, aber ein einziger Augenblick der Stille enthüllte die tiefe Traurigkeit seiner sanften Augen.« So heißt es in der Titelgeschichte über Leo Finkle, jenen Studenten der Theologie, der auf Frauensuche ist – und unerhörte Erleuchtungen erlebt, als er sein Begehren in die Hände des Heiratsvermittlers Pinye Salzman legt.
Und es umreißt – ohne dass ihr Schöpfer im Einzelnen jeweils noch mehr Worte darüber verlöre – treffend und vor allem stellvertretend jene schwer fassbare Gefühlspanne, zwischen der sämtliche in seinem 1959 mit dem National Book Award ausgezeichneten Band Das Zauberfass auftretenden Geschöpfe ihre mehr oder weniger erfolgreich verlaufenden Glückssuchen vollführen.
Bernard Malamuds Protagonisten sind durchweg kleine, im amerikanisch-jüdischen Milieu der 50er-Jahre um Halt und Anerkennung, oftmals aber vor allem um ihre Würde ringende ärmliche Intellektuelle, betrunkene Engel mit menschlichem Antlitz oder leicht aus der Spur geratene Bäcker oder Flickschuster; Wesen, die sich – in die Misere des Außenseitertums geraten – allesamt um Redlichkeit bemühen, darüber aber nicht selten von der einen Verlegenheit in die nächste stolpern.
Wie ihr Schöpfer es dabei wiederkehrend versteht, ihrem zähen und nicht selten verzweifelten Ringen etwas Gewaltiges und nicht selten Anrührendes zu verleihen, das macht seine Storys auch 63 Jahre nach ihrem Erscheinen zu einem literarischen Genuss. Denn so einfach sie auf den ersten Blick in ihrer zwischen Legende, Märchen und bitterer Sozialstudie changierenden Machart auch erscheinen mögen, so beeindruckend ist es, unverändert mitanzusehen, wie der 1986 gestorbene melancholische Moralist Malamud es vermag, seinen armen und nicht selten sprachlosen kleinen, mit sich oder dem Schicksal ringenden Helden auf seine mitfühlende Weise poetische Anmut zu verleihen.
Malamud lesen heißt, in die Seelen der Menschen zu blicken. Und was, bitte schön, kann ein Schriftsteller Größeres leisten, als uns ein solch exquisites Erlebnis zu bescheren?
Peter Henning
Bernard Malamud: »Das Zauberfass und andere Geschichten«. Aus dem Amerikanischen von Annemarie Böll. Kiwi Taschenbuch, Köln 2017, 252 S., 14,99 €
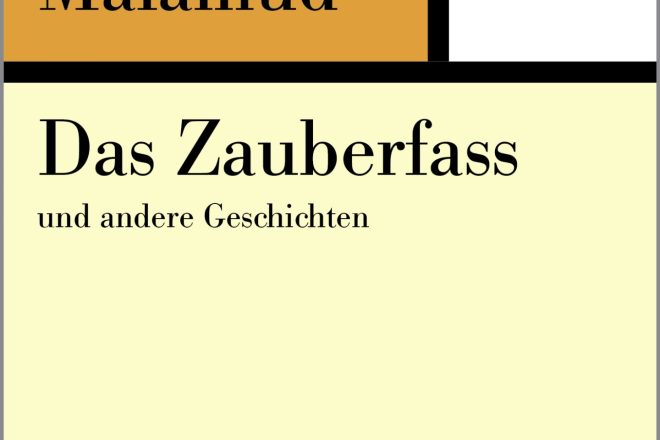
Heiligtum der Liebe
»Das Büro von Rabbiner Nissim Schoschani, 50, im Beit Din des Rabbinats von Tel Aviv. (…) Mit dem Rabbiner unterhält sich sein Sekretär, Jechiel Berkowitz, 30. Es ist Mittwoch, gegen Abend. Später wird Esther Azulai, 38, zum Rabbiner kommen.« So lapidar beginnt die dialogische Novelle Hamikdasch Haschlischi (Der dritte Tempel) von A. B. Jehoschua, die wenige Monate vor dessen Tod am 14. Juni 2022 in Israel erschien.
Dieses kleine Buch ist Unterhaltung auf hohen Niveau – und schildert einen schweren religiösen Konflikt. Denn Esther Azulai, die im Rabbinatsbüro in Tel Aviv über ihre Geschichte sprechen wird, war in ihrer Jugend unsterblich in einen jungen Mann verliebt, der aus einer Familie von Kohanim, Priestern, stammte. Ihr damaliger eifersüchtiger Rabbiner aber gönnte ihr die Beziehung nicht, erkannte den Übertritt ihrer Mutter zum Judentum nicht an – und zwang die junge Frau, erneut zu konvertieren. Doch weil ein Kohen laut Halacha keine Konvertitin heiraten darf, blieb Esther Azulai Single.
Wohl niemand außer A. B. Jehoschua wäre in der Lage gewesen, aus dieser traurigen Geschichte ein so amüsantes Buch zu machen, das zwischen absurder Komödie und einer Utopie angesiedelt ist, wo der Dritte Tempel in Jerusalem erbaut wird – an einer Stelle, die hier nicht verraten werden soll. Dort, so hofft der Autor, wird es »ein Tempel sein, der kein anderes Heiligtum stört« – ein Ort, an dem auch ein verliebter Kohen und eine verliebte Konvertitin ihren Platz finden.
Leider hat der Piper Verlag, der Jehoschuas Bücher in Deutschland herausbringt, bisher keine Übersetzung geplant. Das ist schade, denn das Thema ist zwar speziell – doch mit einigen Erklärungen zu religiösen Begriffen könnte es auch für hiesige Leser ein Vergnügen werden, sich dieses kleine und bei allen Zweifeln derart hoffnungsvolle letzte Buch des israelischen Erfolgsautors zu Gemüte zu führen.
Ayala Goldmann
A. B. Jehuschoa: »Hamikdasch Haschlischi«. Hakkibutz Hameuchad, Tel Aviv 2022, 64 S., 73 NIS

Verflixte Vierecksgeschichte
Es gibt Geschichten, die so zeitlos sind, dass man sie in 500 Jahren noch lesen wird. Cervantes‹ Don Quichote hat die Distanz fast überbrückt. Herman Melvilles Moby Dick ist auf dem Wege dazu, und ich möchte Isaac Bashevis Singers Feinde, die Geschichte einer Liebe nahtlos einreihen.
Sie erschien zunächst in den 50er-Jahren als Fortsetzung im Jiddischen »Forverts« in New York. Singer schrieb all seine Geschichten auf Jiddisch, und sie handelten oft von ihm, selbst in seinen Schtetl-Storys findet sich immer einer wie er, der sich mit dem jüdischen Philosophen Baruch de Spinoza beschäftigt und die Frauen liebt.
Dass der spätere Nobelpreisträger seinen Roman nun in Zeit und Topos hautnah an seinem Leben ansiedelt, mag einen bewussten Bruch darstellen oder innerer Notwendigkeit geschuldet sein; nichts beschreibt den Stadtteil Brooklyn jener Jahre nach dem Holocaust, die Zerrissenheit der Überlebenden und des Protagonisten Herman Broder, Ghostwriter eines medial gut gehenden Rabbiners, so unerträglich und leicht wie Enemies, A Love Story, bis hinab in die Hitze des nächtlichen F-Trains in den »Hundstagen« des August.
Singer hat darin die französische Dreiecksgeschichte um eine vierte Person erweitert. Das polnische Dienstmädchen Yadwiga hat Broder vor den Nazis versteckt. Aus Dankbarkeit nimmt er sie mit in die Emigration und heiratet sie. Er ist sicher – Tamara und seine beiden Kinder sind ermordet worden.
Aber in New York liebt Broder Mascha, über alles. Aufregend, geheimnisvoll, ist Mascha von suizidärer Sehnsucht heimgesucht; zu allem Überfluss taucht Tamara auf – sie hat überlebt. Broder ist vor dem Gesetz Bigamist. Mascha glaubt, schwanger zu sein, und drängt ihn zur Heirat. Auch Yadwiga erwartet ein Kind …
Das Weltbild des freien Philosophen wie des Lesers reißt auf wie die Scholle beim Beben der Erde … bis zum veritablen letzten Satz, den ich niemals vergesse, weil er mir wie von Gotteshand vor Augen führte, welche Liebe Singer eigentlich meint. Oder lesen Sie das, wie ich, jedes Mal anders?
Helmut Kuhn
Isaac Bashevis Singer: »Feinde, die Geschichte einer Liebe«. Hanser, München 1978, 344 S., 24 €

Lust auf noch mehr Tipps? Brot, Bohème, Selbstironie oder Narnia, Kinder, Black Lives Matter









