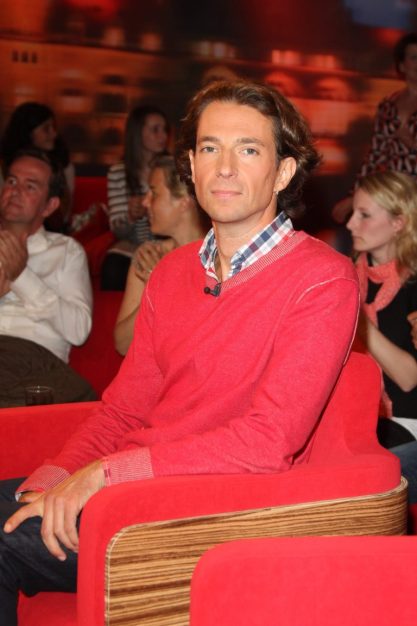Hätte der Kettenraucher diesen Schutzgeist mit seinen Zigarren vertrieben? Oder eher doch mit der Schreibfeder? Jedenfalls dürfte der humanistisch beschlagene Sigmund Freud gewusst haben, dass der Schutzgeist eines Ortes oft in Form einer Schlange auftritt. Auf Latein wurde dieser dann gerne »genius loci« genannt, was im übertragenen Sinne so viel wie »ein anregendes Ambiente« bedeutet.
Das Wien der Jahrhundertwende war für den Seelenanalytiker Freud und die von seinen Theorien und Schriften in Bann geschlagenen Adlaten ein genau solcher. Denn die Hauptstadt der Donaumonarchie, seit Beginn der 1870er-Jahre bis 1914 im ständigen Umbau begriffen, war in dieser Zeit eine intellektuell wie künstlerisch feinnervig vibrierende, hochnervöse, laute und sehr dicht bewohnte Metropole. Kein Wunder, dass ausgerechnet hier die moderne Psychotherapie entstehen sollte.
Ihre 120-jährige Historie erzählt Steve Ayan auf recht plastische Weise, ebenso die Geschichte des US-amerikanischen behavioristischen, labororientierten Verhaltensforschers John Watson oder des Burghölzli bei Zürich. Er lässt die Anfänge der Psychotherapie und ihre wichtigsten Vertreter Revue passieren, neben Freud auch Carl Gustav Jung und Alfred Adler, zudem aufregende Nebenhauptfiguren wie Otto Rank, Melanie Klein, Anna Freud und Jacob Moreno, Carl Rogers und Viktor Frankl.
Erzählerisch süffig zeichnet der Autor, der selbst Psychologe ist, Haupt- und Nebenwege der Erkenntnisseelensuche nach
Erzählerisch süffig zeichnet der Autor, der selbst Psychologe ist, Haupt- und Nebenwege der Erkenntnisseelensuche nach – natürlich auch, wie jüdisch die Psychoanalyse schon immer war. Und dies im immer antisemitischer werdenden Wien, das ab Mitte der 1860er-Jahre zum Kristallisationspunkt jüdischer Migrationsbewegungen innerhalb des Habsburgerreichs wurde. So hatte sich bereits 1882 der Antisemitische Österreichische Reformverein gegründet. »Hinaus mit den Juden!« lautete sein Motto. Die ihm nahestehende Zeitung »Volksfreund« gab die Parole aus: »Kauft nur bei Christen!«
Der Autor zeigt, wie jüdisch die Disziplin schon immer war.
Mit Ablehnungen wurden die Analytiker auch in der akademischen Welt konfrontiert. So hatte beispielsweise Adler zum Wintersemester 1911/12 seine Unterlagen an die Universität Wien gesandt, um die »venia legendi« zu erlangen, und zwar die Berechtigung, Vorlesungen abzuhalten. Wenige Jahre zuvor hatte das bei Freud noch funktioniert. Zwei Jahre lang geschah aber nichts. Erst im April 1914 wurden Adlers Unterlagen gesichtet und einem Gutachter weitergeleitet, einem Professor für Neurologie. Es war Julius von Wagner-Jauregg, ein Mann mit Pferdegesicht, Meckifrisur, mächtigem Schnurrbart und schlangengiftigem »Humor«. 1927 sollte ihm der Nobelpreis für Medizin zugesprochen werden.
Sein zwölfseitiges Gutachten war eine vernichtende Bestandsaufnahme der Psychoanalyse. Bereits auf der ersten Seite hob Wagner-Jauregg hervor, dass sich der »Fall Adler« von ähnlichen Gesuchen »in einem wesentlichen Punkte« unterscheide. Habe es sich bei anderen Habilitationsanträgen um strikt klinische Projekte gehandelt, so sei das, was Adler vorlege, allenfalls »Erklärungen von Krankheiten und Krankheitssymptomen« und die Methode dabei »speculativ«, also unseriös.
Zur Sezession Adlers von Freuds Psychoanalyse meinte der Neurologieprofessor: Adler sei dieser zwar nicht in den Lehrsätzen treu geblieben, aber in den Methoden. Dann holte er aus: »Es ist zum ersten Male, dass ein Jünger dieser Schule sich um die Dozentur bewirbt; und es wird daher notwendig sein, dass das Professoren-Collegium sich etwas eingehender mit der Frage befasse, ob es wünschenswert sei, dass das, was dieser Vertreter der Schule zu lehren hat, an der Wiener medicinischen Fakultät gelehrt werde.« Seine Antwort lautete: definitiv nein!
Kein Land zeigte sich der Psychoanalyse gegenüber so aufgeschlossen wie die Vereinigten Staaten
Zeitgleich hatte sich dagegen kein Land der Psychoanalyse gegenüber so aufgeschlossen gezeigt wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Schon um 1900 war in den USA Psychologie als akademische Disziplin etabliert. Unter der Zuhörerschaft von Freuds 1909 an der Clark University gehaltenen Vorlesungen waren Angehörige der kulturellen Eliten. 1911 hatte sich die American Psychoanalytical Association konstituiert. Es gab bereits eine Psychoanalytic Society in New York, in Boston sollte eine zweite 1914 folgen. Doch das war fern von Wien und dem omnipräsenten Antisemitismus in Europa.
Mit Hinweis auf seinen Protegé, den mythomanen Schweizer Carl Gustav Jung, forderte Freud seinen jüdischen Mitstreiter Karl Abraham auf: »Seien Sie tolerant«, so der Begründer der Psychoanalyse ganz im Duktus seiner Zeit, »und vergessen Sie nicht, dass Sie es eigentlich leichter als Jung haben, meinen Gedanken zu folgen, denn erstens sind Sie völlig unabhängig, und dann stehen Sie meiner intellektuellen Konstitution durch Rassenverwandtschaft näher, während er als Christ und Pastorssohn nur gegen große innere Widerstände den Weg zu mir findet. Umso wertvoller ist dann sein Anschluss. Ich hätte beinahe gesagt, dass erst sein Auftreten die Psychoanalyse der Gefahr entzogen hat, eine jüdische nationale Angelegenheit zu werden.«
Man merkt bei Steve Ayans erzählerisch eingängiger Darstellung, dass er seit mehr als 20 Jahren Redakteur von »Spektrum der Wissenschaft« ist. Sein Buch, für das er Archive mit den in der ganzen Welt verstreuten Nachlässen der Wiener Psychoanalytiker sichtete, überzeugt durch die Lebendigkeit der vorgestellten Personen.
Steve Ayan: »Seelenzauber. Aus Wien in die Welt. Das Jahrhundert der Psychologie«. dtv, München 2024, 400 S., 26 €