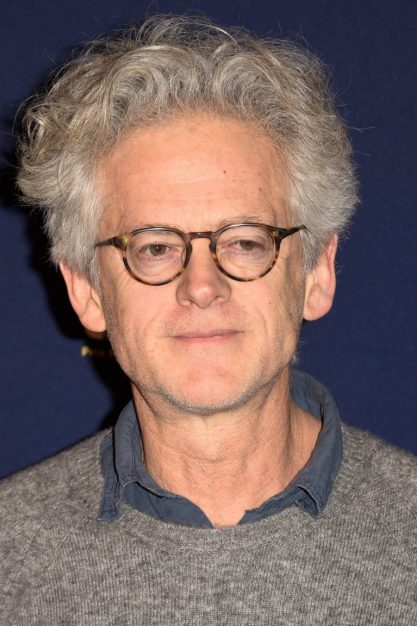Die Diskussion darüber wird schon lange geführt: Wie kann man nach Auschwitz noch schreiben? Doch genau daran knüpft der neue Roman von Santiago Amigorena an. Vorangestellt ist dem Buch ein Zitat von Günther Anders: »Nein, angemessen auf das Maßlose zu reagieren, das war unmöglich.« Und doch wagt Amigorena sich genau daran, nämlich an den Versuch, »das Schweigen zu bekämpfen, an dem ich seit meiner Geburt fast ersticke«.
VERSTUMMEN Kein Ort ist fern genug lautet der Titel des Werks, das im französischen Original 2019 als Le ghetto intérieur und vor einem Jahr im Aufbau-Verlag auch in deutscher Sprache erschienen ist. Trotz der sehr nuancierten Übersetzung durch Nicola Denis wirkt der Originaltitel treffender – wegen seiner Doppelbödigkeit, aber auch, weil er das Wesen des Romans besser abbildet.
Über den Protagonisten des Buches heißt es: »Vicente war ein junger Jude. Oder ein junger Pole. Oder ein junger Argentinier. Eigentlich wusste Vicente Rosenberg am 13. September 1940 noch nicht genau, was er war.« Er zieht sich immer mehr in die innere Isolation zurück. Angesichts der Ungewissheit in Argentinien im Hinblick auf die Verfolgung und systematische Ermordung der Juden in Europa verzweifelt er fast an seiner Ohnmacht – so sehr, dass er irgendwann ganz verstummt.
Amigorena findet Worte, um die Beklemmung mitreißend zu beschreiben. Dass die Isolation, die er in seinem Buch beschreibt, angesichts der Covid-19-Pandemie, während der zahlreiche jüdische Familien wegen Lockdowns und sich ständig ändernder Einreisebestimmungen nach Israel weltweit auseinandergerissen wurden, einen aktuellen Bezug bekommen würde, konnte der Autor beim Schreiben des Romans noch nicht wissen.
Vicente, 1928 von Warschau nach Buenos Aires ausgewandert, trifft sich im Café Tortoni mit seinen Freunden Sammy und Ariel. Dort debattiert er mit ihnen die neuesten Nachrichten und stürzt sich ins Glücksspiel. In den Zeitungsartikeln aus Europa erfährt er von jenen Ereignissen, die ihm nach und nach die Kehle zuschnüren.
NACHRICHTEN AUS EUROPA Vincentes Mutter und ein Teil seiner Familie leben eingesperrt im Warschauer Ghetto. Täglich wartet er auf Post von ihr. Trotz seines Drängens, der Pogrome und des in Europa grassierenden Antisemitismus hatte sie sich geweigert hatte, ihm nach Argentinien zu folgen – »weil Berl und Rachel Polen nicht verlassen wollten und sie sich nicht von ihnen trennen mochte«. Nach und nach kommen ihm Informationen aus Polen unter der NS-Besatzung zu Ohren: »In Warschau haben sie jetzt offenbar auch angefangen, eine Mauer zu bauen ...«, heißt es anfangs – bis sich schnell die Schlagzeilen überschlagen.
Santiago H. Amigorenas Roman ist ein innerer Monolog über den Antisemitismus in Polen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und über die Assimilation seines Protagonisten in Südamerika. Es ist ein Ringen um die jüdische Identität und eine Selbstbefragung. Seit Langem hat Vicente sein Jiddisch vergessen und spricht Spanisch wie ein Argentinier. »Bis auf seinen Freund Ariel nannte ihn niemand mehr Wincenty: Alle nannten ihn Vicente – und er fühlte sich mehr als Argentinier denn als Jude oder Pole.«
Vincente beschreibt seine jüdische Identität als »großen Koffer voller alter, unleserlicher Manuskripte«, den man ein Leben lang mitschleppen müsse.
Die Entfremdung von den eigenen Wurzeln erscheint an manchen Stellen etwas konstruiert, etwa als es heißt, dass er sich sehr schnell als Argentinier fühlte und er es abwegig fand, auf eine Barmizwa zu gehen. Amigorena findet aber auch eingängigere, wenngleich nicht völlig neue Metaphern. So beschreibt Vicente seine jüdische Identität im Gespräch mit Freunden als »großen Koffer voller alter, unleserlicher Manuskripte«, den man ein Leben lang mitschleppen müsse.
ANEKDOTEN Die Schuldgefühle wegen der zurückgelassenen Mutter und Selbstzweifel zerfressen ihn: »Er hasste sich dafür, dass er sich wie ein Pole fühlte, noch mehr aber dafür, dass er einmal Deutscher hatte sein wollen. Er sollte einen doppelten Hass auf sich selbst empfinden ...«
Zwischen den Spiegelwänden des Café Tortoni debattiert Vicente mit seinen Freunden anfangs noch angeregt die Geschehnisse. Vom Madagaskar-Plan bis hin zum Frotzeln beim Billardspiel über die halachischen Regeln – bis er irgendwann verstummt und sein Umfeld mit seinem Schweigen fast erdrückt.
Kein Ort ist fern genug ist ein ergreifendes Buch, dessen etwas anekdotenhafter Erzählstil sich streckenweise an der Grenze zum Kitsch bewegt. Die Beschreibung der verständnisvollen, treuen Ehefrau Rosita ist arg tradiert. Auch die Anekdoten rund um das Warschauer Ghetto wirken mitunter deplatziert. Dennoch ist Amigorenas Rückblick interessant, dokumentiert er doch die Perspektive eines aus der dritten Generation nach der Schoa schreibenden Autors, der hier seine Familiengeschichte verarbeitet hat.
Ist diese märchenhaft-melancholische Erzählweise und die versatzstückhafte Aneinanderreihung von Geschehnissen eine angemessene Art und Weise, über die Schoa zu schreiben? Le ghetto intérieur ist ein Roman, der einen vielleicht gerade wegen seines Erzählstils noch länger beschäftigt und durch die Covid-19-Pandemie vielleicht unverhofft eine neue Aktualität bekommen hat.
Santiago H. Amigorena: »Kein Ort ist fern genug«, aus dem Französischen von Nicola Denis, Aufbau Verlag, Berlin 2020.